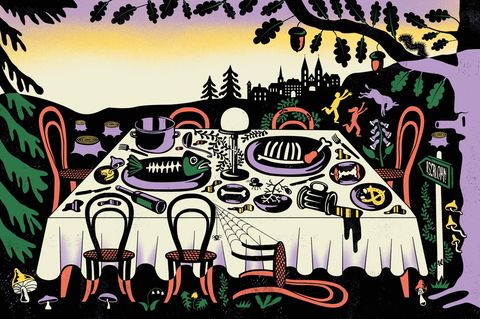Es sollte ein Leuchtturmprojekt für Klimaschutz und regionale Entwicklung werden – doch nun ist ein drittes Biosphärengebiet für Baden-Württemberg vorerst vom Tisch. Nach jahrelanger Prüfung wurde das Schutzgebiet Allgäu-Oberschwaben nun offiziell gestoppt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Befürwortern und Gegnern - und der Ausstieg vieler Gemeinden.
Tatsächlich war der Widerstand vor Ort massiv: Landwirte, Förster, Bürgermeister, Gemeinderäte – sie alle äußerten Sorgen vor zu viel Bürokratie und zu wenig Mitbestimmung. Auch wirtschaftliche Akteure wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) meldeten Skepsis an.
Die sogenannte Allianz für Allgäu-Oberschwaben, ein Zusammenschluss kritischer Stimmen, warnte vor Einschränkungen bei Bauprojekten und landwirtschaftlicher Nutzung: "Die Risiken überwiegen, da ein Biosphärengebiet auf der gesamten Fläche ein Schutzgebiet nach Bundesnaturschutzgesetz wäre", hieß es aus dem Kreis der Gegner. "Wo sind da die konkreten Chancen?"
Was ist eigentlich ein Biosphärengebiet?
Dabei klang alles zu Beginn nach Aufbruch. Im Koalitionsvertrag von 2021 hatte sich die grün-schwarze Landesregierung darauf verständigt, ein drittes Biosphärengebiet für den Südwesten zu prüfen – nach den Vorbildern auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Allgäu-Oberschwaben sollte folgen, weil 80 Prozent der Moorböden Baden-Württembergs sich in der Region liegen. Die Schutzfläche sollte 67.500 Hektar groß sein - das ist etwa ein Viertel des Saarlands.
Ein Biosphärengebiet ist eine ausgewählte Region, in der Menschen, Natur und Wirtschaft im Einklang leben und arbeiten sollen – etwa durch naturnahe Landwirtschaft, Moorschutz oder nachhaltigen Tourismus. Es geht darum, konkrete Wege zu finden, wie Umwelt geschützt und gleichzeitig die regionale Wirtschaft gestärkt werden kann.
Genau darin sahen die Befürworter große Chancen: Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Naturschutzbunds NABU, sprach nach der Absage von einer "verpassten Chance für Mensch und Natur". Millionenbeträge an möglichen Fördergeldern seien verloren – auch, weil sich "einflussreiche Landeigentümer" gegen das Projekt gestellt hätten, so Enssle.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?
Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.
Gemeinden müssen mitziehen – viele taten es nicht
Für die Landesregierung kommt das Aus nicht ganz überraschend. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hatte sich erst kürzlich gegen das Schutzgebiet ausgesprochen. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) betonte: Die Entscheidung liege bei den Kommunen. Auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald seien Biosphärengebiete sehr erfolgreich – dort träten sogar weitere Gemeinden bei.
Anders in Oberschwaben: Besonders die Ablehnung dreier Schlüsselgemeinden – Bad Waldsee, Bad Wurzach und nächste Woche vermutlich auch Ostrach – sorgte Experten zufolge für das politische Aus. "Leider Gottes ist das so", sagt der Unternehmer Gottfried Härle, einer der regionalen Befürworter. Für den Brauereibesitzer aus Leutkirch im Allgäu ist klar: "Oberschwaben vergibt sich hier eine große Chance. Diese kommt so nicht wieder."
Misstrauen, Missverständnisse, Polarisierung
Härle kritisiert, dass viele Gegner sich kaum mit den Inhalten beschäftigt hätten. Stattdessen sei mit "Halbwahrheiten und viel Angst" gearbeitet worden. Auf der Schwäbischen Alb und in Ländern wie Österreich oder der Schweiz habe man längst gezeigt, wie positiv sich Biosphärengebiete entwickeln könnten – ökologisch wie wirtschaftlich.
Die Polarisierung sei zu groß geworden, der Dialog zu schmal, heißt es auch im offiziellen Abschlussbericht des Steuerungskreises. In einem offenen Brief an die Umweltministerin schreiben die kommunalen Vertreter: Die gesellschaftlichen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hätten den Raum für einen faktenbasierten Austausch schrumpfen lassen. "Sehr engagierte, aber auch stark polarisierende Positionen" hätten das Klima vergiftet.
Was bleibt, ist also ein Projekt mit viel Potenzial – und einem Ende, das niemand wirklich wollte. Denn die Gegner selbst sehen sich nicht als Sieger. Man wolle nicht gewinnen, sondern "die beste Lösung für die Region", hieß es von den Gegnern. Das geplante Biosphärengebiet sei es aus ihrer Sicht nicht.