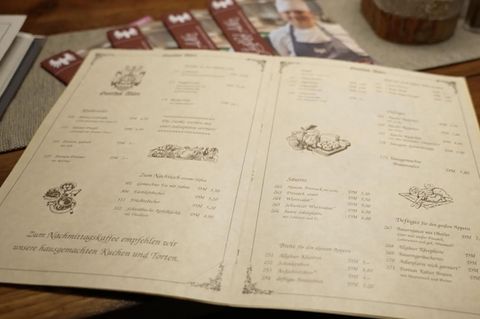Nationalsozialisten wie Hermann Göring liebten Kunst. Und sie scheuten nicht davor zurück, jüdischen Menschen ihre Schätze zu rauben oder abzupressen. Mehr als 80 Jahre nach Ende des Terrorregimes warten viele Opfer immer noch auf die Rückgabe dieser NS-Raubkunst. Bayern will nun Tempo machen. Doch was muss alles geschehen? Das zeigt der Bericht einer externen Untersuchungskommission zur Provenienzforschung an den Staatsgemäldesammlungen, der im Landtag vorgestellt wurde. Darin gibt es viele Vorschläge, einige Kritik, aber auch lobende Worte.
Über Jahrzehnte "versäumt, verschleppt"
Die Hauptforderungen des Gremiums im Ausschuss für Kunst und Wissenschaft: Verbindliche Verfahren für den Umgang mit NS-Raubkunst, mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation. Man müsse nun all das aufarbeiten, was über Jahrzehnte "versäumt, verschleppt oder vielleicht auch verschleiert" wurde, sagt Meike Hopp, die Leiterin der Kommission.
Viel Gutes, aber keine Struktur
Manches sei in Bayern gar nicht so schlecht aufgestellt, so habe es hier 1999 eines der ersten Projekte zur Provenienzforschung gegeben. Hopp lobte zudem eine "solide Recherchepraxis und methodische Tiefe", fachliche Standards würden konsequent eingehalten. Doch was fehlte, war eine Struktur: "Das organisatorisch unzureichend strukturierte Vorgehen führte beispielsweise dazu, dass zentrale Werkkomplexe bislang nicht systematisch bearbeitet werden konnten, insbesondere rund 3.000 Objekte, die nach 1945 erworben oder inventarisiert wurden", heißt es in dem Bericht.
Die Untersuchung erscheint rund acht Monate nach Presseberichten, die Missstände in der renommierten Sammlung anprangerten, zu der auch die Pinakotheken in München zählen. Dabei ging es auch um den Umgang der Sammlung mit möglicher NS-Raubkunst. Die Prüfung solcher Verdachtsfälle wurde als intransparent und schleppend kritisiert, sogar von Vertuschung war die Rede. Auch Kritik an den internen Zuständen in den Pinakotheken wurde laut. Im April musste der langjährige Generaldirektor Bernhard Maaz gehen, ihm folgte Anton Biebl, der als neuer Leiter schon viele Veränderungen eingeleitet hat, um die internen Abläufe und die Stimmung zu verbessern.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?
Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.
"Wilde Monate" bei den Staatsgemäldesammlungen
"Es waren für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wilde Monate", sagt Kunstminister Markus Blume (CSU), will aber nicht von einem Skandal sprechen und verweist auf die Untersuchungsergebnisse. Das Gros der Vorwürfe sei haltlos, es gebe keine Anhaltspunkte für Organisationsversagen und Fehlverhalten. Nicht bestätigt habe sich auch der Vorwurf, irgendwo würden Konvolute von Gemälden lagern, die gesichert Raubkunst seien und die den Erben vorenthalten würden.
Neben den Vorwürfen zum Umgang mit Raubkunst-Fällen war auch interne Kritik laut geworden. Vorwürfe sexueller Belästigung von Besuchern durch das Sicherheitspersonal bestätigten sich laut Blume, nicht dagegen Vorwürfe wegen Schwarzarbeit oder Sicherheitsmängeln. Das Vorbringen, Mitarbeiter seien bespitzelt worden, habe man nicht aufklären können. Es sei aber auch klar, dass bei den Staatsgemäldesammlungen vieles im Argen gelegen habe, so Blume.
"Riesenberg Arbeit"
Nun wartet also ein "Riesenberg Arbeit", wie es der Minister formuliert, vor allem bei der Klärung, welche Objekte Raubkunst sind. Mit Stand Oktober zählten 82 Werke laut Bericht zur roten Kategorie. Hier besteht also ein Raubkunst-Verdacht. Hinzu kommen 446 als orange gekennzeichnete Objekte, bei denen die Herkunft zweifelhaft ist.
Doch das ist womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Rund 3.000 weitere Kunstwerke, die die Sammlung nach 1945 erworben hat, wurden in dieser Hinsicht nur sehr oberflächlich überprüft. Hier müsse es zügig eine eingehendere Prüfung geben, so Blume, der von einer vordringlichen Aufgabe für die nächsten "Monate und ein, zwei Jahre" spricht.
Museen aus Behördendasein führen
Damit die Arbeit gut vorankommt, will Blume die Museen aus dem "Behördendasein" herausführen. Die Provenienzforschung soll künftig bei der staatlichen Museumsagentur angesiedelt sein. Fünf Stellen würden dazu neu geschaffen und eine Million Euro als Sondermittel bereitgestellt, kündigte er an. Im Doppelhaushalt 2026/2027 hofft der Minister auf weitere vier Millionen Euro. Beraten soll bei allem der Runde Tisch Historische Verantwortung unter Vorsitz des langjährigen Direktors des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ), Andreas Wirsching. Und strittige Fälle sollen vor das Schiedsgericht, das sich im Dezember konstituieren soll.
"Wir stehen uneingeschränkt zur Restitution", resümierte Blume. Der Maßstab müsse sein: "whatever it takes", was immer auch notwendig sei. Das müsse auch bei künftigen Haushaltsverhandlungen gelten, falls noch mehr Geld notwendig sei.
Gefühl wie in den 50er-Jahren?
Für so viel Ehrgeiz gibt es Lob von der Opposition: "Ich bin froh und dankbar, dass sich jetzt was bewegt und dass es weitergeht", sagt Sanne Kurz, kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. "Wir haben 80 Jahre nach Kriegsende eine Situation, wo man so tut, als wenn wir Mitte der 50er Jahre hätten und gerade bemerkt hätten, dass die NS-Diktatur zu Ende ist."
Buntes fürs Publikum
Auch das Museumspublikum soll die Änderungen bald merken. Ab März sollen Kunstwerke mit fragwürdiger Herkunft in den Pinakotheken mit bunten QR-Codes versehen werden. Wer hier draufklickt, erfährt Wissenswertes, etwa zur Herkunft und zur Geschichte.