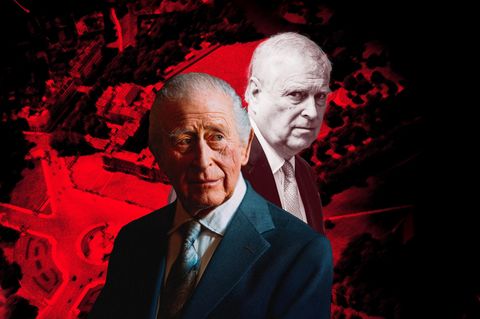Im Krieg der Zukunft sollen Drohnen heikle Missionen fliegen. Auch die Bundeswehr will sie haben. Was kaum bekannt ist: Deutsche Forscher entwickeln bereits ein neues Modell – im Auftrag der Waffenindustrie.
Im Frühsommer 2011 stellte die Bundeswehruniversität München eine unscheinbare Anzeige ins Netz. Gesucht wurde ein Studienabsolvent mit Spitzennoten, einer „ausgeprägten Neigung zu experimentellen Arbeiten“ und Kenntnissen in der Programmiersprache C++. Wenn er sich gut anstellen würde, könnte der Kandidat in drei Jahren den Titel „Dr.-Ing“ tragen. Was nicht im Anforderungsprofil stand: Eine Vorliebe für heikle Forschung sollte er ebenfalls mitbringen. Das verrieten vier Buchstaben im Anzeigentext: UCAV. Die Abkürzung steht für Unmanned Combat Air Vehicle, übersetzt: unbemanntes Kampfflugzeug.
Die Bundeswehruniversität hatte schon einige Monate vorher den Projektvertrag unterschrieben und suchte jetzt noch einen Doktoranden. Seine Aufgabe würde es sein, zusammen mit anderen Forschern am Modell einer neuartigen Drohne zu bauen, die für Radarsysteme so gut wie unsichtbar ist. Die Firma Cassidian hatte die Hochschule damit beauftragt, eine Tochter des Großkonzerns EADS. Cassidians Geschäft sind Waffen, das Unternehmen baut zum Beispiel Raketen und den Kampfjet Eurofighter.
Mit klassischer Kriegstechnik allein wird sich in Zukunft allerdings immer weniger Geld verdienen lassen. Als größter Wachstumsmarkt der Rüstungsbranche gelten leise, pilotenlose Fluggeräte: Drohnen. Militärs preisen sie als sauber, präzise und sicher – zumindest für die eigenen Soldaten. Für die europäische Rüstungsindustrie geht es um viel: Wenn es ihr nicht bald gelingt, eigene kampffähige Drohnen zu liefern, droht sie von der Konkurrenz aus Amerika und Israel abgehängt zu werden.
Deshalb tüfteln Ingenieure und Forscher von Unternehmen wie Cassidian unter Hochdruck an neuen Entwicklungen (im Bild: die Drohne Eurohawk bei einem Testflug). Und Spezialisten von öffentlichen Universitäten und Forschungsinstituten lassen sich von ihnen einspannen. So wie bei Sagitta, dem Drohnenprojekt, für das die Bundeswehruniversität München im Sommer vor zwei Jahren einen Doktoranden suchte.
Anfang 2011, wenige Monate zuvor, hat Cassidian das Projekt gestartet. Mit dabei: vier deutsche Hochschulen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 21 Doktoranden werkeln seitdem an einem futuristisch aussehenden Drohnenmodell. Die Bundeswehruniversität München und die TU München entwickeln die Steuerung, Informatiker der TU Chemnitz forschen daran, wie der Flieger Landebahnen ohne Pilot erkennen kann. Am DLR basteln Wissenschaftler und Techniker an Fahrwerk, Steuerungselektronik und Energieversorgung. Die Hochschule Ingolstadt macht ebenfalls mit. Regelmäßig tauschen sich die Spezialisten per Telefonkonferenz über ihre Fortschritte aus.
Das Design der Drohne erinnert an Tarnkappenbomber
Der Projektname „Sagitta“ bedeutet auf Latein „Pfeil“. Ein symbolischer Name. Animationen des Modells zeigen einen Flugkörper, der aussieht wie aus einem Science-Fiction-Streifen: rautenförmig, vorne spitz zulaufend und flach wie eine Scheibe. Ein fliegender Mantarochen. Drohnen mit dieser Form sind für Radarsysteme aus großer Entfernung unsichtbar. Besser bekannt sind sie als Tarnkappendrohnen. Die so genannte Nurflügler-Konstruktion lasse auf einen militärischen Einsatz schließen, sagen Experten.
Cassidian finanziert das Projekt größtenteils selbst – aber auch die Hochschulen und das DLR schießen Geld aus ihren Etats bei. Sie bezahlen Büros und Computer der Doktoranden selbst. Ein guter Deal für beide Seiten: Cassidian freut sich über den „Zugang zu Spitzenabsolventen der Ingenieurswissenschaften“ und den „aktuellsten Trends an der Forschungsfront“. Die Unis können mit dem Geld von Cassidian Nachwuchswissenschaftler anheuern.
Einer von ihnen ist Nikolaus Theißing, 26. Der studierte Elektrotechniker schreibt seine Doktorarbeit über Sagitta. Natürlich habe er sich Gedanken über die Auswirkungen seiner Forschung gemacht, sagt Theißing. „Aber ich vertraue darauf, dass unsere Arbeit in gute Hände fällt.“
Woran Wissenschaftler in Deutschland arbeiten, kann ihnen niemand vorschreiben. Es sei denn, ihre Hochschule lehnt freiwillig jegliche kriegsnahe Forschung ab und hat das in einer so genannten Zivilklausel festgeschrieben. Aber nur eine Handvoll Universitäten haben solche Vorschriften. Außerdem lassen sie sich leicht umgehen, da sie meist schwammig formuliert sind.
Die Entwickler von Cassidian wollen ihr Drohnenmodell spätestens in zwei Jahren fertig bauen. Eine Spannweite von drei Metern soll es haben, maximal 150 Kilogramm wiegen und 400 Stundenkilometer schnell fliegen können. Es ist üblich, dass die Ingenieure zunächst ein Modell mit verkleinerten Maßen konstruieren. „Technologie-Demonstrator“ heißt das auf Wissenschafts-Deutsch. Zwischen einem solchen Demonstrator und einer serienreifen Drohne liegen zehntausende Arbeitsstunden. Laut Cassidian wird es nie so weit kommen, dass eine Drohne des Typs „Sagitta“ die Fabriken des Konzerns verlässt. Es handle sich bei dem Projekt um Grundlagenforschung, an dem man neue Technologien ausprobieren wolle.
Dass Cassidian die Forschung betreibt, ohne an ein späteres Produkt zu denken, ist trotzdem zweifelhaft. In einer Broschüre von EADS heißt es über Sagitta, man wolle den „Fokus der Forschung mittel- bis langfristig in eine geschäftsorientierte Richtung für unbemannte/autonome Flugsysteme“ lenken.
Erstaunlich ist, dass die Konstrukteure selbst nicht genau sagen können, was Sagitta zu einem Kampfdrohnenmodell macht. Das geplante Fluggerät habe weder Waffenschacht noch Raketenaufhängungen, sagt Aimo Bülte, Entwicklungschef von Cassidian. Den Forschungspartnern zufolge macht aber allein die futurische Form den Flieger zu einem UCAV-Demonstrator. Denn damit seien Eigenschaften verbunden, die eine Drohne im militärischen Einsatz brauche.
Auch die Bundeswehr will Kampfdrohnen anschaffen
Der Bedarf an bewaffneten Drohnen ist groß. Ein amerikanisches Marktforschungsinstitut prognostiziert, dass Regierungen im Jahr 2022 weltweit 11,4 Milliarden US-Dollar für Drohnen ausgeben werden, fast doppelt so viel wie heute. Deutlich wie nie hat sich Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) kürzlich dafür ausgesprochen, Kampfdrohnen für die Bundeswehr anzuschaffen.
Offen ist bislang, wie die Bundeswehr an sie kommt. Schon jetzt setzt die Luftwaffe Aufklärungsdrohnen vom Typ „Heron 1“ in Afghanistan ein, geleast vom Hersteller Israel Aerospace Industries. Diese ließen sich relativ leicht zu Kampfdrohnen aufrüsten. Am besten aber – zumindest für die heimische Rüstungsindustrie – wäre eine eigene europäische Entwicklung.
Opposition und Kirchenvertreter kritisieren de Maizières Vorstoß scharf. Sie fürchten, dass Deutschland mit bewaffneten Drohnen in einen umstrittenen Krieg einsteigt. „Kampfdrohnen senken die politische Hemmschwelle für weitere Kriegseinsätze, weil sie die Illusion eines Krieges ohne eigene Opfer nähren“, sagt der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko von der Linken.
Eine amerikanische Studie belegt, dass Drohnen längst nicht so präzise sind wie oft behauptet. In Pakistan haben die lautlosen Flieger seit 2004 bis zu 880 Zivilisten getötet. Schätzungen zufolge sind nur ein Bruchteil der Opfer von Drohnenangriffen „hochrangige Ziele“. Aber selbst in Afghanistan, wo internationale Streitkräfte mit einem Nato-Mandat kämpfen, dürfen Kampfdrohnen nicht einfach Menschen umbringen, sagt der Völkerrechtler Christian Tomuschat: „Es ist unzulässig, einen potenziellen Aufständischen stundenlang zu beobachten und ihn erst dann zu töten, wenn er mit seiner Familie Mittag isst.“
Der Verteidigungsminister will noch vor der Bundestagswahl entscheiden, ob die Bundeswehr Kampdrohnen anschafft. Er kann sicher sein: Cassidians Ingenieure werkeln eifrig. 2015 soll Sagitta zum ersten Testflug abheben.
von: Ann-Kathrin Nezik
Foto: Cassidian dpa