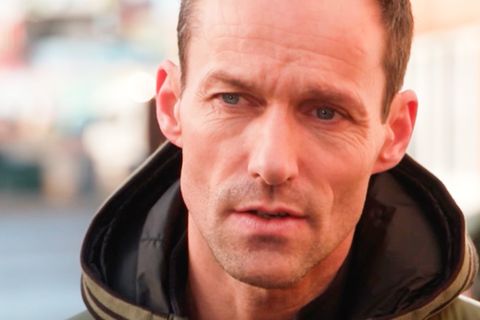Nerven sind wichtig - gerade in unserer strapaziösen Zeit. Das zeigt sich auch im täglichen Sprachgebrauch: Überall ist von Leuten die Rede, die "genervt" oder auch "entnervt" sind, Leuten, die "Nerven zeigen" oder nicht zeigen, aber auch solchen "ohne Nerven", wie etwa die bewunderten, die sich an einem Seil 50 Meter in die Tiefe stürzen. Da sind auch diejenigen, welche "die Nerven verlieren", also ebenfalls ohne Nerven sind, und dabei gewalttätig werden, eher zur Verwunderung als zur Bewunderung. Das alles kann recht verwirrend sein, auch "auf die Nerven gehen" oder sogar "nervtötend" sein.
Ausflüge in das neue Deutsch
Die Nerven sind ein Ausflugsort des Autors Eike Christian Hirsch in seinem neuen Buch "Gnadenlos gut. Ausflüge in das neue Deutsch" (Verlag C.H. Beck, 160 S., 12,90 Euro). Für Hirsch ist klar: Nerven soll man haben. Mit den Leuten "ohne Nerven" ist es also schon mal nichts. Haben soll man sie, nur nicht zeigen - das verstehe einer. "Klar, wer Nerven zeigt, wird sie auch bald verlieren, wo doch alles darauf ankommt, sie zu behalten, zu bewahren und sogar zu beweisen", schreibt Hirsch weiter. "Ja, beweisen! Es ist schon sonderbar, dass ich Nerven beweise, wenn ich sie gerade nicht zeige. Wie soll ich etwas beweisen, ohne es zu zeigen? Das geht nur bei den Nerven."
Besonders wichtig sind die Nerven für Politiker. In hitzigen Debatten kommt es darauf an, den "Nerv zu treffen". Dabei muss er allerdings aufpassen, dass er den richtigen Nerv trifft - nämlich den Nerv der Sache, am besten gleich den "nervus rerum", den manche mit dem Geld gleichsetzen.
"Reine Nervensache"
Bei Journalisten sind die "blanken Nerven" sehr beliebt. "Im Pentagon liegen die Nerven blank", wollte einer wissen, als es im Irak 2003 militärisch nicht gleich wie erwartet voranging. In jedem Fußballclub werden blank liegende Nerven ausgemacht, vom Manager bis zum Trainer, wenn die Mannschaft mehrere Spiele hintereinander verloren hat. Blanke Nerven immer wieder auch in Führungsetagen der Parteien und der Wirtschaft. Hirsch erinnern sie an "grässliche anatomische Darstellungen". "Aber ruhig bleiben, reine Nervensache", rät er.
"Verschleierungssprache"
Jubilare werden gerne als "70 Jahre jung" befunden. Alte Menschen gibt es ohnehin kaum noch, dafür umso mehr "Senioren". Eckhard Henscheid nennt sie in seinem inzwischen zum Klassiker gewordenen "Dummdeutsch"-Wörterbuch ein "Musterexemplar von einer Verschleierungs-, ja Verhöhnungssprache". Er entwirft dazu über die "Seniorenwohnsitzgemeinde" hinaus die Perspektive eines "Seniorenentsorgungsparks".
"Schanzenhistoriker" Hannawald
Eher als Opfer einer missglückten Adelungsabsicht erscheinen Sportler, von denen es wegen einer einzigartigen Erfolgsserie heißt, sie hätten "Geschichte geschrieben" - auch wenn sie kein einziges Wort geschrieben haben, sondern mit ihren Erfolgen ja mehr als das, nämlich Geschichte gemacht haben. Eine Zeitung erklärte vor einiger Zeit den Skispringer Sven Hannawald sogar zum "Schanzenhistoriker". Zur jüngsten Geschichtsschreiberin wurde kürzlich wegen ihrer Turniersiege 2004 die 17 Jahre alte russische Tennisspielerin Maria Scharapowa ernannt.
Hirsch betrachtet das neue Deutsch meist eher amüsiert und verwundert. Henscheid ist oft kritisch-bissiger. Für das, was sich dem Erscheinen von Henscheidts Wörterbuch vor knapp 20 Jahren verändert hat, nennt Hirsch entsprechende Beispiele. Bei der Entwicklung mag zwar manches, wie man sieht, "dumm gelaufen" sein, nicht alles "Sinn machen", was da "so mal ganz locker" gesagt, "ungeschützt in den Raum gestellt" oder "angedacht" wird - aber man kann jedenfalls, "echt!" auch seinen Spaß dran haben.