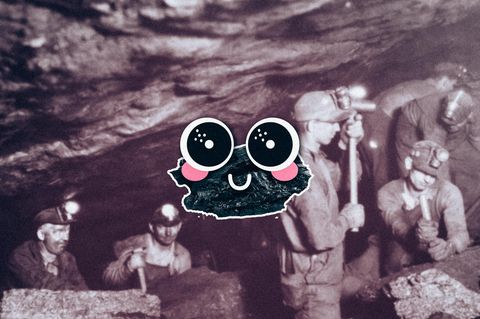Wer "Dolly" heißt, kann so gefährlich nicht sein. Unter "Bertha" stellt man sich eine nette alte Dame vor. Und auch "Cindy" klingt nicht wie jemand, der Hunderttausende Menschen in den Tod reißt, oder? Menschen schätzen Hurrikane mit weiblichen Vornamen offenbar harmloser ein als Stürme mit Männernamen – mit fatalen Folgen: Kiju Jung von der Universitt Illinois und sein Team haben in einer Reihe von Experimenten herausgefunden, dass Menschen vor einem „männlichen“ Hurrikan eher die Flucht ergreifen als vor einem weiblichen.
Darum hätten "weibliche" Hurrikane in den USA zwischen 1950 und 2012 mehr Todesopfer gefordert als männliche, schreiben die Psychologen im Magazin "PNAS". Geschlechtervorurteile seien mitunter so ausgeprägt und hartnäckig, dass sie im Katastrophenschutz stärker berücksichtigt werden sollten. "Das Problem ist, dass der Name eines Hurrikans nichts mit seiner Schwere zu tun hat", bemängelt Hauptautor Jung. Sturmnamen werden in den USA recht willkürlich vergeben: Seit den 1970er Jahren bekommen sie abwechselnd weibliche und männliche Namen von einer bereits vor der Hurrikan-Saison festgelegten Liste. "Das kann sehr gefährlich sein, wenn Menschen das Gefahrenpotenzial eines Sturms anhand seines Namens einschätzen sollen", sagt Jung.
In einem Experiment baten die Wissenschaftler rund 350 Probanden, die Intensität verschiedener hypothetischer Hurrikane vorauszusagen: Wie schlimm wird wohl ein "Arthur", "Cristobal" oder "Kyle" ausfallen? Und wie gefährlich ist ein Sturm namens "Dolly", "Fay" oder "Laura"? Tatsächlich schätzten die Befragten die maskulin getauften als bedrohlicher ein. Auf einer Skala von 1 (harmloser Sturm) bis 7 (sehr starker Sturm) bewerteten die Probanden männliche Namen im Mittel mit 4,4, weibliche mit 4,2.
Frauen gelten als weniger aggressiv
"Bei der Beurteilung der Sturmintensität lassen sich Menschen von ihrem Bild von typisch männlichen und weiblichen Verhaltensweisen beeinflussen", erklärt Mitautorin Sharon Shavitt. "Frauen werden als wärmer und weniger aggressiv als Männer betrachtet. Deshalb erscheinen ihnen feminin getaufte Hurrikane milder und weniger gewaltig."
Auch scheint die Ankündigung eines "männlichen" Sturms Menschen eher dazu zu bewegen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen: Die Forscher teilten rund 140 Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein: Einige von ihnen erhielten eine Wetterkarte, die den fiktiven Hurrikan "Christopher" anzeigte, die restlichen bekamen die gleiche Karte mit einem Sturm namens "Christina" vorgelegt. Anschließend fragten die Wissenschaftler alle Teilnehmer, ob sie sich evakuieren würden, wenn der jeweilige Sturm ihr Zuhause träfe. Die Bereitschaft, sich in Sicherheit zu bringen, war zwar bei beiden Gruppen hoch. Wer sich mit "Christina" konfrontiert sah, war allerdings etwas weniger gewillt, sein Heim zu verlassen und Schutz zu suchen als ein von "Christopher" Bedrohter. Ähnliches ergaben Experimente mit dem Namenspaar "Alexander" und "Alexandra" sowie "Victor" und "Victoria".
Allein indem man einen Hurrikan von weiblich auf männlich umtaufe, könne man die Zahl der Todesopfer womöglich auf rund ein Drittel verringern, so die Forscher. "Das sind ungeheuer wichtige Erkenntnisse. Sie belegen, dass unsere kulturell festgelegten Assoziationen auch unsere Handlungen steuern", so der Verhaltensforscher Hazel Rose Markus von der Stanford University, der nicht an der Studie beteiligt war.
Die Aussagekraft der Experimente ist allerdings begrenzt. Denn mit Vornamen verknüpfen wir nicht nur geschlechtsspezifische Vorstellungen, sondern auch andere Gedanken und sogar Gefühle wie Sympathie und Abneigung, die sich auf unser Urteil auswirken könnten. Ältere Untersuchungen haben ergeben, dass wir bestimmte Namen mit Attraktivität verbinden. Eine Befragung der Wissenschaftlerin Astrid Kaiser zeigt zudem, dass Grundschullehrer kleinen Kevins schlechtere Leistungen zutrauen als Simons. Dennoch resümieren die Forscher, dass es sinnvoll sein könnte, das System der Namensgebung zu ändern.