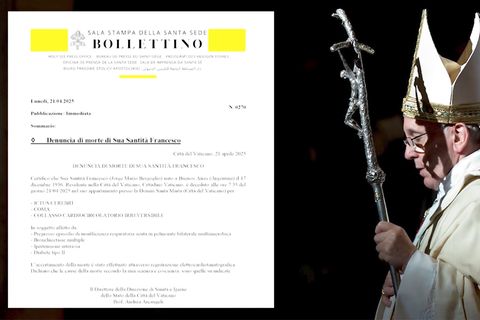Grundsätzlich kann jeder über sein Vermögen frei verfügen und dieses auch beliebigen Erben vermachen - über die Ausnahme Pflichtteil haben wir schon geredet. Denn nur innerhalb dieser Pflichtteil-Grenzen kann der Erblasser beliebig schalten und walten, jemanden bedenken oder enterben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die gesetzliche Erbfolge aus- und seinen letzten Willen durchzusetzen: Testament und Erbvertrag.
Das Testament
Die gebräuchlichste Form, seinen letzten Willen kund zu tun, ist das Testament. Nicht jeder darf ein Testament machen, also »testierfähig« sein. Die Voraussetzung ist die Geschäftsfähigkeit. Die erreicht man meist mit der Volljährigkeit, also mit 18 Jahren. Teenager dürfen unter bestimmten Umständen schon mit 16 Jahren, dann aber nur bei einem Notar. Insgesamt sind einige wichtige Formvorschriften zu beachten, sonst wäre die ganze Mühe umsonst, und das Testament ist ungültig.
Das eigenhändige Testament
Der Erblasser muss es ganz, also wirklich den ganzen Text, mit der Hand schreiben. Es geht nicht, dass z.B. nur der Titel »Testament« und die Unterschrift handschriftlich sind. Nur so kann sicher gestellt werden, dass der gesamte Text vom Erblasser stammt, deshlab muss auch der Text mit vollem Namen unterschrieben werden. Die Unterschrift muss immer am Textende stehen. Es ist zwar nicht vorgeschrieben, Ort und Datum anzugeben, es wäre aber besser. Ein zu einem späteren Zeitpunkt verfasstest Testament hebt nämlich ein früheres auf und kann so leichter erkannt werden. Gibt es am Schluss des Testaments noch einen Nachtrag, muss auch danach wieder unterschrieben werden damit klar ist, dass dieser Zusatz testamentarisch gültig sein soll. Ist ein Testament mehrere Seiten lang, sollten die Seiten nummeriert und jedes einzelne Blatt unterschrieben werden. So können 'missliebige' Textpassagen von späteren Erben nicht einfach unterschlagen werden.
Wichtig: Keine Unklarheiten
Dafür ist es völlig egal, ob Sie Ihren letzten Willen auf einer Postkarte, einer Speisekarte, einem kleinen oder großen Blatt hinterlassen. Wichtig ist nur, dass Sie darin ganz klar und unmissverständlich sagen, wer Ihre Erben sind und was jedem einzelnen zugedacht ist. Um wirklich sicher zu gehen, dass es keine Unklarheiten gibt, empfiehlt es sich, die Erben mit Vor- und Zunamen, sowie dem Geburtsdatum zu benennen.
Ein neues Testament ersetzt ein altes
Ein Testament kann auch jederzeit geändert oder rückgängig gemacht werden, indem man ein neues schreibt. Ausnahme: Hat sich jemand durch einen Erbvertrag oder einem gemeinschaftlichen Testament mit dem Ehepartner gebunden, kann er nicht mehr einfach den Inhalt durch ein späteres Testament ändern, aber dazu später mehr. Wird ein Testament vernichtet, ohne dass ein neues aufgesetzt wird, greift wieder die gesetzliche Erbfolge. ? Ebenso, wenn das Testament wegen Formfehler ungültig ist. Generell sollte man sein Testament alle zehn Jahre überprüfen, ob man als Erblasser mit dem Inhalt noch so einverstanden ist, außerdem verändert sich in solch einer Zeitspanne ja auch das Vermögen.
Gemeinschaftliches Testament
Dieses wird ? wie der Name schon sagt ? von Eheleuten gemeinsam aufgesetzt. Damit geht man schon zu Lebzeiten eine starke rechtliche Bindung ein, im Gegensatz zum Erbvertrag ist ein Widerruf aber immerhin möglich. Der Vorteil: Die Eheleute können sich auf die einmal gefassten Pläne verlassen. Hier setzt dann ein Ehepartner das Testament handschriftlich auf, unterschreiben müssen zwingend beide. Paare, die ohne Trauschein zusammenleben sind davon ausgeschlossen, gleichgeschlechtliche Partner, die in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft leben, nicht.
Beispiel
(stellen Sie sich das jetzt aber bitte in Handschrift vor:
Wir, Rüdiger und Ottilie Rücker, setzen uns hiermit gegenseitig als Vollerben unseres gesamten Nachlasses ein. Schlusserbe des Letztversterbenden soll unsere gemeinsame Tochter Astrid sein.
Nürnberg, den 20. Februar 2002 + Unterschriften1 + Ort, Datum + Unterschrift 2
So ein gemeinschaftliches Testament kann nur von beiden Eheleuten gemeinsam geändert werden. Solange beide Eheleute leben, kann auch einer einzeln durch »Widerruf« aussteigen, muss diesen Widerruf aber bei einem Notar beurkunden lassen (Sie ahnen es: gegen Gebühr). Das gemeinschaftliche Testament erlöscht bei der Scheidung der Eheleute. Setzen diesee dann nicht jeder für sich ein neues Testament auf, greift wieder die gesetzliche Erbfolge.
Heikle Wortwahl
Entscheidend beim gemeinschaftlichen Testament ist die Wortwahl, weil hier sehr viele Varianten möglich sind, die dann auch unterschiedliche Rechtsfolgen haben. Wird der überlebende Gatte z.B. als »Vorerbe« bezeichnet, so hat er über den Nachlass nur eine beschränkte Verfügungsgewalt. Er darf nichts verkaufen oder durch Hypothek belasten. Soll er freie Verfügungsmacht haben, muss er im gemeinschaftlichen Testament als »Vollerbe« und die nachfolgenden Kinder als »Schlusserben« bezeichnet werden. Es gibt aber noch den »befreiten Vorerben« und diverse andere Klauseln ? eine Beratung macht also durchaus Sinn. Steuerlich gesehen ist diese Testamentsform sowieso nicht wirklich ratsam. Aber dazu in einer anderen Folge mehr.
Die Aufbewahrung
Besser als die Küchenschublade oder der Wäscheschrank ist ein sicherer Ort für den letzen Willen ? schließlich soll er ja auch gefunden werden. Deshalb sollte auch mindestens eine Vertrauensperson wissen, wo das Testament zu finden ist. Ganze Krimis leben ja von der Handlung, dass ein darin nicht Bedachter das Testament einfach verschwinden lässt. Der sicherste Weg der Verwahrung ist deshalb immer noch das Nachlassgericht. Hier ? oder bei der Nachlassabteilung des Amtsgerichts ? könne Sie das Testament zur amtlichen Aufbewahrung geben, selbstverständlich gegen Gebühr. Diese Gebühr richtet sich nach dem Wert des Vermögens: bei 5.000 Euro sind das etwa 10 Euro, bei 50.000 Euro müssen rund 32 Euro gezahlt werden. Der Vorteil: Das Gericht erfährt immer von Ihrem Tod und eröffnet dann den Erben den Inhalt.
Der Profi hilft
Natürlich kann man sich von einem Experten helfen lassen, wenn man sich in der Formulierung unsicher ist oder generell vorher Beratung braucht. Dazu kann man zu einem Notar oder Rechtsanwalt (RA) gehen. Hier hat man dann mehrere Möglichkeiten: Man gibt seinen Willen mündlich wieder und Notar oder RA schreiben ihn nieder. Bei der »Errichtung durch mündliche Erklärung« muss der Erblasser tatsächlich seine Willen mündlich gegenüber dem Notar erklären ? Lallen oder Kopfnicken gelten nicht. Verliest der Notar einen von ihm selbst aufgesetzten Text, muss der Erblasser diesen zumindest nach einzelnen Absätzen mit »Ja«, »Einverstanden« oder »stimmt so« bestätigen.
Öffentliches Testament
Man kann Notar oder RA aber auch eine offene oder geschlossene Schrift (damit ist z.B. ein Briefumschlag gemeint) mit den Worten geben: »Dies ist mein Testament«. Ist der Brief (die Schrift) offen und kann sich Notar, bzw. RA von der Richtigkeit der Angabe überzeugen, wird er 'zeugnisfähig'. Dann, und nur dann, muss das Testament nicht eigenhändig geschrieben sein. Jetzt kann es in jeder Form (Computerausdruck, Schreibmaschinenseiten, in fremder Sprache, in Blindenschrift, ausgefüllter Vordruck) aufgesetzt sein, ist aber immer noch nur mit Unterschrift gültig. Natürlich kostet auch das öffentliche Testament Gebühren, die sich nach einer Tabelle aus dem Vermögenswert berechnen. Aber man kann damit auch sparen, denn das öffentliche Testament ersetzt den »Erbschein«. Diesen müssen sich die Erben nach einem Todesfall gebührenpflichtig beim Nachlassgericht ausstellen lassen, wenn nur ein handschriftliches Testament vorliegt. Mit dem Erbenschein beweisen sie dann ihre rechtmäßige Stellung als Erben und können dann so z.B. an die Bankkonten des Verstorbenen.
Außerordentliche Testamente
Der Vollständigkeit halber seien noch die außerordentlichen Testamente erwähnt, die dann zum Einsatz kommen, wenn man aus einer Notlage heraus nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen handschriftlich niederzuschreiben (z.B. nach einem Autounfall oder einer Naturkatastrophe). Für solche Fälle hat der Gesetzgeber folgende Varianten vorgesehen:
* das Nottestament
vor dem Bürgermeister. Dazu muss man seinen letzten Willen vor dem Bürgermeister seines Ortes und zwei weiteren Zeugen mündlich erklären.
* das Dreizeugentestament.
Hier erklärt man seinen letzen Willen vor drei Zeugen.
* das Seetestament.
Dazu muss man nicht in Todesgefahr sein, aber an Bord eines deutschen Schiffes außerhalb eines deutschen Hafens und drei Zeugen bei sich haben, denen man seinen Willen erzählt.
Stirbt man nach Erklärung seines letzten Willens durch ein Nottestament doch nicht, wird dieses hinfällig.
Der Erbvertrag
Eine weitere Form, seinen letzen Willen zu regeln, ist durch einen Erbvertrag. Den schließt ein Erblasser mit einer anderen Person. Meist wird eine Gegenleistung dafür verlangt, dass diese andere Person im Erbvertrag die Stellung eines Erben bekommt. Inhalt kann sein, dass sich die Nichte dazu verpflichtet, nach Ihrem Tod das Grab zu pflegen. Oder man lässt sich vor dem Tode von der Enkelin pflegen, setzt diese aber dafür im Erbvertrag mit einer höheren Summe ein, weil sie es »verdient« hat. Für den Abschluss des Erbvertrages muss man zum Notar gehen, und auch hier gilt: Die Gebühr für die Fertigung richtet sich wie beim öffentlichen Testament nach der Höhe des Vermögens. Diese Verträge sind bindend, man sollte sich also vorher eingehend beraten lassen und vom Notar etwaige Rücktrittsrechte oder Anfechtungsgründe erklären lassen (z.B. wenn die Enkelin ihrer Aufgabe zu pflegen, gar nicht nachgekommen ist).