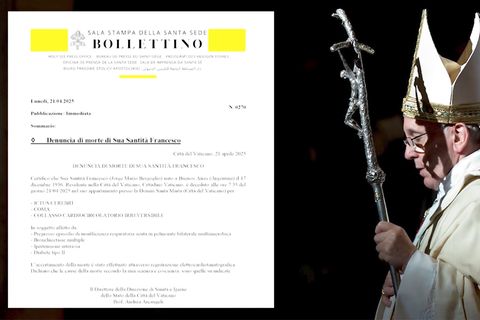Nicht ohne Grund heißt das Testament auch »letzter Wille«, denn darin hat der Erblasser auch das Recht zu bestimmen, was tatsächlich mit seinem Vermögen geschehen soll. Im Juristendeutsch heißt dies »Testierfreiheit«. Trotzdem gibt es auch hierbei Grenzen: Egal, wie zuwider ihm manche nahe Verwandte sind ? ganz ausschließen kann sie der Erblasser nicht. Diese nahne Verwandten haben Anspruch auf wenigstens einen kleinen Teil des Erbes, nämlich den bereits besprochenen Pflichtteil.
Es gibt aber auch genug Fälle, wo die ganze Erbschaftsverteilung nicht so abläuft, wie es sich der Verstorbene vorgestellt hat. Ein häufiger Fall: Was passiert z.B. wenn der Erblasser seine heimliche Geliebte im Testament bedenkt?
Die 'heimliche' Lösung
Die Diskussion der letzten Jahre hat sich hauptsächlich auf die Probleme der Rechtssprechung bei der 'nichtehelichen Lebensgemeinschaft' konzentriert. Inwieweit man einen Freund oder eine Freundin im Testament bedenken kann, zu der man neben einer aufrechten Ehe eine (auch sexuelle) Beziehung unterhält, ist wenig erörtert. Denn in so einem Fall geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Sinn der Erbschaft eine Belohnung für die 'geschlechtliche Hingabe' sein soll. Aus Bankenkreisen wird diskret geraunt, dass in solchen Fällen die Zuwendung am erfolgreichsten so erfolgt, dass die betreffende Person Vollmacht über ein Konto oder Wertpapierdepot im In- oder Ausland hat, von deren Existenz die Familie nichts weiß. Im Todesfall ist dann eine schnelle Umschreibung auf den Namen der bevollmächtigten Person möglich. Dies ist also ein Beispiel für die Variante: »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«, weil die andere Person gar nicht erst im Testament auftaucht.
Das Geliebtentestament
Ehrlicher, wenn auch ungeschickter, ist die Erwähnung des/der Geliebten im Testament. Gehen wir im folgenden von einer Geliebten aus - juristisch gesehen stellen diese Fälle ja auch die Mehrheit dar. Womöglich läuft das Testament auch noch darauf hinaus, dass die Geliebte zur Alleinerbin eingesetzt wird und Ehefrau und Kinder oder andere Verwandte leer ausgehen. Früher waren die Gerichte hart. So ein »Geliebtentestament« hatte keine Chance auf Erfolg, weil es fast immer als 'sittenwidrig' angesehen wurde und damit ungültig war. 1970 änderte der Bundesgerichtshof diese Rechtssprechung, und seitdem werden diese Geliebtentestamente nicht mehr automatisch als sittenwidrig angesehen, nur weil zwischen Erblasser und Begünstigter ein außereheliches Verhältnis bestand. Im Gegenteil: Wer sich übergangen fühlt - und das ist meist der Ehepartner - muss jetzt erst einmal beweisen, dass das Verhältnis nur »sexuell geprägt war«. Dass dabei keine Gefühle im Spiel waren. Nur dann kann das Testament angefochten werden.
Das Heimgesetz
Nicht nur übergangene Verwandte können die wunschgemäße Ausführung des letzten Willen sabotieren, auch Behörden sind darin gut. Wenn z.B. jemand in einem Altenheim wohnt und den Träger dieses Heimes bedenken will, gibt es einen kaum bekannten Fallstrick: das Heimgesetz.
Beispiel:
Ein kinderloser Witwer lebt zufrieden im Heim und will das Altenheim als Erben einsetzen. Um alles wasserdicht zu machen, wird ein Notar bestellt, und im Beisein des Heimleiters bekundet der alte Mann seinen entsprechenden letzten Willen. Nach dem Tod machen die Verwandten ihren Anspruch auf das Erbe geltend und haben tatsächlich Recht bekommen. Das Heimgesetz untersagt es nämlich dem Träger eines Heimes, sich über das Entgelt für Unterbringung und Pflege hinaus Zuwendungen versprechen zu lassen. Damit soll verhindert werden, dass der Heimträger mit Rücksicht auf schon empfangene oder versprochene Zuwendungen einzelne Bewohner bevorzugt behandelt oder sich Heimbewohner durch diese Freigiebigkeit eine besondere Form von Zuwendung erkaufen. Ganz besonders soll vermieden werden, dass der Heimträger dadurch womöglich ein besonderes Interesse am baldigen Tod des Heimbewohners hat. Nach dem Sinn der Vorschrift ist dies aber nur ungültig, wenn die Verantwortlichen des Altenheims von der Erbschaft wussten. Macht man still und heimlich sein Testament und sagt niemanden etwas darüber, kann man durchaus auch sein Heim testamentarisch bedenken.
Ähnlicher Fall: Zivildienstleistende
Alte Menschen neigen dazu, Pflege und Zuwendung belohnen zu wollen. Es kann also durchaus sein, dass ein »Zivi« in einem Testament bedacht werden soll. Der Pferdefuß hier: Das Bundesamt für Zivildienst muss informiert sein und der Einsetzung als Erben zustimmen. Und das tut es meist nicht, weil auch ein Zivildienstleistender in seiner Tätigkeit von Gefälligkeiten unbeeinflusst bleiben soll.
Darf der Kanarienvogel erben?
Es ist natürlich nur ein schlechter Juristenwitz: »Eine alte Dame hatte kurz vor ihrem Tod ihren geliebten Kanarienvogel als Alleinerben eingesetzt. Dieser letzte Wille wurde aber nicht wirksam, weil die Katze das Testament angefochten hat.« Trotzdem spricht er etwas an, worüber sich sicher der eine oder andere Gedanken macht: Kann man seinem Haustier etwas vererben, um es auch nach dem eigenen Tod abzusichern?
Klare Antwort: Nein, es kann nicht Erbe werden. Man kann aber im Testament eine vertrauenswürdige Person bestimmen, die sich nach dem Tod um das Tier kümmert. Man vermacht dann dieser Person einen bestimmten Geldbetrag, verbunden mit der Auflage, das Geld für die Pflege des Tieres einzusetzen.
Das Vermächtnis
Mit einem »Vermächtnis« können Sie auch Menschen etwas zukommen lassen, die keine Erben (also mit Ihnen verwandt) sind. Diese Menschen haben dann einen Anspruch gegen die Erbengemeinschaft auf das, was ihnen testamentarisch vermacht wurde: z.B. ein bestimmtes Bild oder ein Schmuckstück oder ein Geldbetrag. Dieser Anspruch kann zur Not auch vor Gericht gegen die Erbengemeinschaft eingeklagt werden.
Die Auflage
Sie können als Erblasser in Ihrem Testament Erben mit bestimmten Aufgaben betrauen: z.B. sich um ein Haustier zu kümmern oder nach Ihrem Tod das Grab zu pflegen. Damit das auch wirklich geschieht, können Sie die gemachte Zuwendung ?unter Auflage? machen. Das heißt nichts weiter, als dass die Erbschaft wieder entzogen wird, wenn der gestellten Aufgabe nicht ordentlich nachgekommen wird. So etwas bedarf logischerweise der Kontrolle. Und das ist der Moment, wo ein besonderer Mensch auftritt.
Der Testamentsvollstrecker
Gerade dann, wenn es um die Einhaltung wichtiger Auflagen geht, oder wenn der Erblasser Streit unter seinen Erben befürchtet, wird häufig ein Testamentsvollstrecker eingesetzt, der die Verteilung des Erbes im Sinne des Verstorbenen regeln soll. Mit dieser Aufgabe, die Nachlassangelegenheiten zu regeln, kann jede volljährige, voll geschäftsfähige Person betraut werden. Klug wäre es, möglichst keinen Erben einzusetzen, weil so schon wieder Streit programmiert ist (»den Bock zum Gärtner machen«).
Auch kann man niemanden zwingen, Testamentsvollstecker zu werden. Es ist also eine gute Idee, als Erblasser vorher mit der auserkorenen Person zu reden, damit diese keine traurige Überraschung erlebt. Der Testamentsvollstrecker muss dann für die Erben ein Inventar machen und feststellen, ob und wie viel Schulden da sind. Dann muss der letzte Wille des Erblassers vollstreckt werden - wozu auch gehört, dass die Schulden aus dem Vermögen gezahlt werden. Für seine Arbeit wird er mit einer 'angemessenen Vergütung' aus dem Vermögen bezahlt. Richtwerte dafür kann man bei den Nachlassgerichten erfahren.