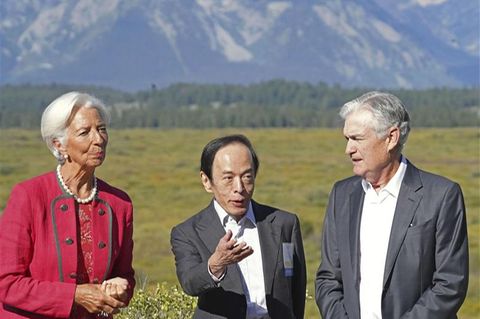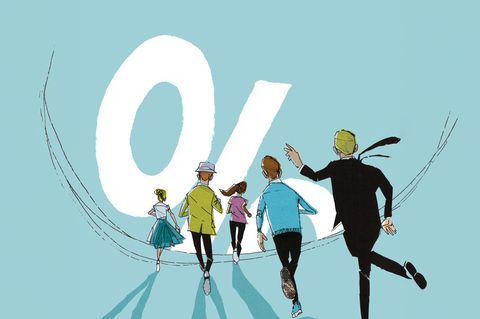Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) war vorauszusehen: Sie hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent angehoben. Damit ist dessen Niveau so hoch wie seit knapp sieben Jahren nicht mehr.
Die EZB nimmt mit dem Zinsbeschluss ihren vor mehr als einem Jahr wegen der Finanzkrise unterbrochenen Kampf gegen die Inflation wieder auf. Die Teuerungsrate in der Währungsunion war zuletzt wegen explodierender Energie- und Nahrungsmittelpreise auf den Rekordwert von vier Prozent gestiegen. "Die Inflation ist die Sorge Nummer eins der Bürger Europas. Sie können auf uns zählen. Wir werden tun, was nötig ist, um Preisstabilität zu gewährleisten", sagte Notenbankchef Jean-Claude Trichet.
Der Grund für die Zinserhöhung: Die Notenbank ist besorgt über eine zu hohe Inflation im Euroraum. Doch was genau steht hinter dieser Begründung? Was hat der Leitzins mit dem Preisniveau zu tun und inwiefern betrifft das die EZB? stern.de gibt Antworten.
Was ist der Leitzins?
Im Fachjargon ist der Leitzins der "Refinanzierungssatz" der Geschäftsbanken bei der Zentralbank - also der Zinssatz, zu dem Banken bei der Zentralbank Kredite aufnehmen. In Europa wird er von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegt. Sie steuert mit dem Zinssatz die Geldmenge, um darüber Einfluss auf die Preisentwicklung zu nehmen.
Am Donnerstag wurde der wichtigste Leitzins von der EZB um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent erhöht. Seit Juni 2007 hatte der Leitzins konstant bei vier Prozent gelegen. In den USA heißt der Leitzins "Federal Funds Rate". Seit August 2007 hat die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) diesen Refinanzierungssatz schrittweise von 5,25 auf zwei Prozent gesenkt.
Welche Auswirkungen haben Zinssenkungen und -erhöhungen?
Wird der Leitzins gesenkt, kann damit die Wirtschaft stimuliert werden. "Wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins senkt, sinken auch die Zinsen für Unternehmer- und Konsumentenkredite", sagt Manfred Neumann von der Universität Bonn. Kredite werden billiger, der Anreiz für Unternehmen zu investieren, steigt.
Gleichzeitig jedoch wachse die Geldmenge M3, erklärt Neumann. Die ist definiert als die Bestände an Bargeld, die Sichteinlagen - also Geld, worauf Bankkunden sofort zugreifen können wie zum Beispiel auf dem Girokonto - und die Spar- und Termineinlagen. Letztere können kurz- und mittelfristig abgehoben werden.
Gefahr von Zweitrundeneffekten
Zunächst würden also einerseits mehr Güter produziert (da steigende Kapazitäten), andererseits sei mehr Geld auf dem Markt, womit die produzierten Güter gekauft würden. "Aber irgendwann können die Kapazitäten nicht mehr hinreichend ausgedehnt werden", sagt Neumann, "spätestens dann beginnt das Preisniveau stärker als gewöhnlich zu steigen."
Gefährlich seien in dem Fall sogenannte Zweitrundeneffekte: "Arbeitnehmer verlangen mehr Geld, weil sie sehen, dass die Preise steigen", erklärt Neumann. So steige langfristig die Geldmenge schneller als die Produktionskapazitäten, es komme zu einer Lohn-Preis-Spirale. Die Preise steigen, das Geld verliert an Wert.
Andersherum wirke sich eine Zinserhöhung kontraktiv auf die Wirtschaft aus, sagt Neumann: "Unternehmer- und Konsumentenkredite werden dadurch ja teurer", so der Professor, "Investitionen und Konsum steigen langsamer oder sinken sogar." Die Konjunktur werde gedämpft, die Inflation allerdings auch.
Was ist die Aufgabe der EZB?
Die Aufgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sind in der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) festgelegt. Da steht: "Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten." Konkret bedeutet dies: Die Inflation im Euroraum sollte unter zwei Prozent liegen.
Das Ziel einer Stimulierung der Konjunktur ist dem der Preisstabilität zudem eindeutig untergeordnet: "Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen", lautet die Satzung. Die Ziele der Gemeinschaft Satzungs-Artikel zwei zufolge: ein hohes Beschäftigungsniveau und ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum.
Grundsätzlich ist die Zentralbank komplett unabhängig. Die nationalen Regierungen oder die EU-Kommission haben keine Möglichkeit, auf die Zinsentscheidungen der Bank Einfluss zu nehmen. Sie können allenfalls, wie in der aktuellen Debatte, öffentlichen Druck auf die Bank aufbauen. Politische Forderungen an die EZB wurden von der Notenbank bislang jedoch immer ignoriert.
Ist die Zielsetzung der amerikanischen Fed anders?
Der Hauptunterschied zwischen den Zielsetzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der amerikanischen Federal Reserve (Fed) ist, dass Letztere die Konjunktur stärker im Blick hat: "Die Fed hat als gesetzliche Aufgabe, sowohl für Preisstabilität als auch für eine hohe Beschäftigung zu sorgen", sagt Wirtschaftsprofessor Manfred Neumann. "Das heißt, in welchem Maße sie sich mehr um das eine oder andere Ziel kümmert, ist ihr überlassen." Für die EZB hingegen hat die Preisstabilität eindeutig Vorrang vor der Konjunktur.
Worum dreht sich die aktuelle Debatte?
Die Inflation in der Eurozone liegt zurzeit deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB): Der Prognose der Statistikbehörde Eurostat betrug sie im Juni dieses Jahres vier Prozent. Da erscheint es nur logisch, den Leitzins zu erhöhen, um die Inflation abzuschwächen.
Jedoch ist die EZB in einem Dilemma: Das Wachstum in der Eurozone schwächelt. Eine Zinserhöhung könnte diese Entwicklung noch verschärfen. Ökonom Manfred Neumann hält allerdings das Ziel der Preisstabilität in der aktuellen Situation für wichtiger: "Ich glaube, die Zinsentscheidung ist richtig", sagt er. "Das allerdings reicht nicht: Im September sollte man den Zinssatz noch einmal um 25 Basispunkte erhöhen."