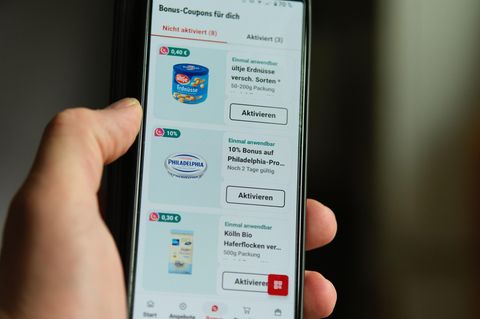Den Fleischer um die Ecke gibt es nicht mehr, und zum Supermarkt dauert es eine halbe Stunde mit dem Auto. In vielen ländlichen Gegenden wird der Weg zum Einkaufen für die Kunden immer länger. Abseits der großen Städte lässt sich der Konkurrenzkampf im Handel an der Landkarte ablesen: An Stelle vieler kleiner Standorte setzen nicht nur Discounter auf Filialen mit weiterem Einzugsgebiet - und locken dort dank geringerer Kosten mit Schnäppchenpreisen. Die teureren Dorfläden setzt das unter Druck. Verbraucherschützer warnen, dass noch mehr Menschen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe verlieren.
"Die Abwärtsentwicklung bei der Versorgung ländlicher Regionen muss gestoppt werden", fordert Edda Müller, Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Selbst aus vielen größeren Gemeinden seien Läden für Lebensmittel und andere Alltagswaren verschwunden. Bis zu acht Millionen Menschen seien bundesweit "unterversorgt": Sie haben kein Geschäft im Umkreis von einem Kilometer. Und die Lage verschärfe sich weiter. Denn der Wandel im Handel werde zum sozialen Problem. Vor allem für Ältere, Menschen mit Behinderungen oder kleinem Einkommen heiße es immer öfter: "Wer nicht fahren kann, hat Pech."
Zunahme von mobilen Verkäufern
Dabei hat das Sterben der traditionellen Kaufmannsläden in der dünn besiedelten Fläche schon lange begonnen. In den vergangenen 40 Jahren sank die Zahl der Lebensmittelgeschäfte bundesweit von einst 160.000 auf nur noch 60.000, wie es in einer Studie des Berliner Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung heißt. Zugleich verschärfte der Siegeszug von Aldi, Lidl und Co. den Wettbewerb massiv. Im Preiskampf sind die Anforderungen an profitable Standorte gestiegen. Damit die Kaufkraft der Kundschaft stimmt und sich die Kosten rechnen, lautet die Vorgabe vieler Ketten: mindestens 700 Quadratmeter Ladenfläche, mindestens 6000 Einwohner im Einzugsgebiet.
Um von günstigen Preisen und größerer Auswahl zu profitieren, steigen die Kunden denn auch immer häufiger ins Auto. Wurde vor 20 Jahren jeder zweite Einkauf zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt, ist es jetzt nur noch jeder dritte. Läden mit kleinerem Sortiment und höheren Preisen in der Nachbarschaft haben da oft das Nachsehen. "Die Kunden im Ort entscheiden, ob ein Geschäft ein Auskommen hat", heißt es beim Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE). Insgesamt sei die Versorgung des ländlichen Raumes aber nicht in Gefahr. Wo Läden geschlossen werden, kämen mehr und mehr mobile Verkäufer in die Siedlungen, zum Beispiel mit Lastwagen als Minimärkten auf Rädern.
Der Strukturwandel hat auch die Großstädte erfasst
Den Verbraucherzentralen reicht das nicht aus. Um im Wettbewerb mit der Massenware der Discounter zu bestehen, sollten Geschäfte in kleinen Orten auf regionale Produkte setzen und dafür werben. Bei der Genehmigung von Neuansiedlungen dürfe die Bürgermeister-Rivalität um Gewerbesteuereinnahmen gewachsene Einkaufsstrukturen nicht zerstören. Da sei es gut, dass die Deutsche Post gerade ankündigte, für einen Test im Herbst 300 neue Kleinfilialen auf dem Land einzurichten. Denn für Briefmarken oder Überweisungen an einem Sparkassenschalter lassen sich Kunden auch in Dorfläden locken. Der Einzelhandel biete sich für solche Partnerschaften gut an, sagt HDE-Sprecher Hubertus Pellengahr.
Dass sich die Entwicklung zurückdrehen lässt, glaubt indes kaum jemand. Um weiteren Nachfrageschwund zu verhindern, müsse letztlich die Abwanderung aus dem ländlichen Raum gestoppt werden, heißt es beim Deutschen Landkreistag. Wie in vielen kleinen Orten hat der Strukturwandel der Branche aber auch schon die Großstädte erfasst. In Innenstädten von Berlin bis Köln stehen zusehends Ladenflächen leer. Dagegen eröffnen an Autobahnauffahrten und Gewerbegebieten immer neue Supermärkte und Shoppingzentren auf der so genannten grünen Wiese. Das klingt zwar wie auf dem Land - ist aber kurz vor der Stadt.
Sascha Meyer/DPA