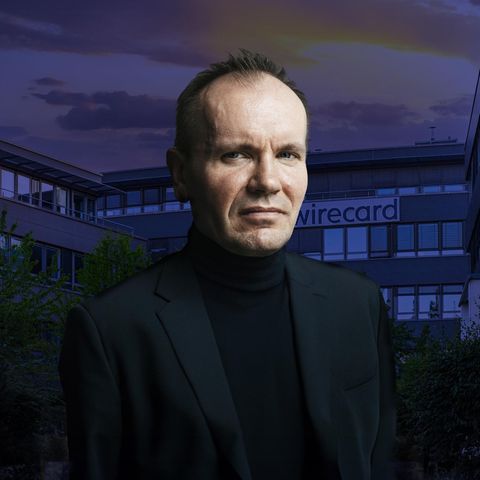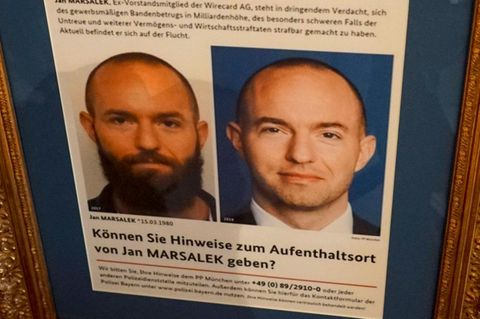An diesem Donnerstag hätte der Fall Wirecard einmal mehr Börsengeschichte schreiben können. Mehr als fünf Jahre nach der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters entschied der Bundesgerichtshof in letzter Instanz über die Klage von Aktionären, die verlangen, wie andere Gläubiger des Pleitekonzerns behandelt zu werden. Geht es nach den Klägern, sollen auch betrogene Aktionäre Ansprüche auf Zahlungen aus der Insolvenzmasse haben.
Wäre das höchste deutsche Zivilgericht der Pilotklage der Fondsgesellschaft Union Investment gefolgt, hätte dies weitreichende Auswirkungen auf den Kapitalmarkt in Deutschland gehabt. Im konkreten Fall von Wirecard hatten rund 50.000 Aktionäre Forderungen von mehr als 15 Milliarden Euro beim Insolvenzverwalter angemeldet – bei einer Insolvenzmasse von bisher rund 650 Millionen Euro. Wenn bei den Quotenzahlungen aus der Insolvenzmasse jedoch auch die Anteilseigner berücksichtigt würden, gäbe es automatisch weniger Geld für andere Gläubigergruppen, die nach der Insolvenzordnung vorrangigen Zugriff haben, vor allem Fremdkapitalgeber. Die Folge: Banken und andere Fremdkapitalgeber könnten sich bei der Finanzierung zurückhalten.
Doch der IX. Zivilsenat des BGH, der für das Insolvenzrecht zuständig ist, hat nun gegen die klagenden Aktionäre entschieden. In diesem Punkt schreibt der Fall Wirecard keine Börsengeschichte – und das ist auch richtig so.
Aus gutem Grund werden Aktionäre nach der Insolvenzordnung anders gestellt als Fremdkapitalgeber. Wer Miteigentümer eines Unternehmens ist, muss auch die Risiken tragen – auch im Fall einer Pleite. Dieser Grundsatz, dass Eigenkapital haftet, muss auch bei Konzernen gelten, die wie Wirecard in Bilanzmanipulationen oder anderen kriminellen Machenschaften untergehen.
Genug Warnsignale bei Wirecard
Ihre Klage haben die Anwälte von Union Investment im Wesentlichen darauf gestützt, dass die Fondsgesellschaft vom Wirecard-Vorstand getäuscht worden sei. Doch dieses Argument verfängt nicht: Zum einen haben gerade Fondsgesellschaften und andere institutionelle Großanleger besondere Zugänge zu den Vorständen der Konzerne, in die sie investiert sind. Im Fall Wirecard gab es über viele Jahre zahlreiche Warnungen, dass dort getrickst wird. Vertreter von Union Investment hätten dazu den Vorstand hartnäckig unter Druck setzen können – und im Fall von unbefriedigenden Erklärungen die Konsequenzen ziehen und aussteigen können.
Zum anderen können Aktionäre – anders als etwa Kreditgeber – praktisch jederzeit ihr Geld in Sicherheit bringen, wenn ihnen ein Engagement zu heiß wird. Bei Wirecard gab es ausreichende Alarmsignale für Aktionäre – spätestens als knapp zwei Monate vor der Pleite das Ergebnis einer Sonderuntersuchung vorlag. Nicht von ungefähr reduzierte Union Investment nach dieser Sonderuntersuchung das Engagement bei Wirecard deutlich.
Das heißt aber nicht, dass Aktionäre von Wirecard oder anderen Skandalkonzernen ihren Schaden einfach hinnehmen müssen. Nur darf der Weg zu einer Kompensation nicht über das Insolvenzrecht führen. Die richtige Adresse für Ansprüche ist nicht der Insolvenzverwalter, sondern es sind andere: die früheren Vorstände, bei denen allerdings finanziell nicht viel zu holen ist, vor allem aber der Wirtschaftsprüfer, der die manipulierten Bilanzen über Jahre abgesegnet hat. Im Fall Wirecard klagen deshalb auch Tausende Anleger gegen den Prüfkonzern EY. Umso ärgerlicher ist es, dass diese Verfahren seit Jahren nicht richtig vorankommen.
Capital ist eine Partnermarke des stern. Ausgewählte Inhalte können Sie mit Ihrem stern+ Abo sehen. Mehr aus Capital finden Sie auf www.stern.de/capital.