Wie kommt es, dass ein Komiker über das Böse schreibt? Die Verbindung der beiden Welten ist näher, als es im ersten Moment scheint. Komik ist Tragik in ihrer Umkehrung. Komik ist das Dunkle, ans Licht des Lachens gebracht. Komiker sind meist Menschen, die Außenseiter waren. Humor ist eine Waffe mit Worten, um sich vor einer Karriere als Underdog zu bewahren. Wo andere gute Leistungen im Sport erbringen oder nerdige Genies sind, benötigt der Komiker den Witz als Rettungsring, um nicht unterzugehen. Das war genau meine Vita in den früheren Jahren.
Mit der Zeit wurde mir klar, dass auch die Komik, diese so freie Kunstform, ihre Grenzen hat. Es gibt Erfahrungen, die sich schlecht bis gar nicht in Pointen abbilden lassen. So begab ich mich auf die Suche nach einer anderen Sprache und anderen Aspekten meiner Biographie. Meine Diagnose lautet: Wir verlagern das Böse nach außen, um uns nicht damit auseinandersetzen zu müssen, um uns als die Guten fühlen zu können. Das Böse ist unser Spiegel, in den wir nicht schauen wollen. So kam ich auf die Idee, dass ich, als Autor eines Buches über das Böse, ein Opfer meiner eigenen Absichten wäre, wenn ich mich weigerte, auch die dunklen Seiten meiner eigenen Geschichte zu erzählen. Draußen beleuchten und das Innere im Dunkeln lassen – das wäre wie ein kettenrauchender Lungenfacharzt.
Das Böse existiert in uns allen
Das Böse existiert in uns allen, auch in mir, und es gab eine Phase, in der ich eine regelrechte panische Angst davor hatte, dass es mich irgendwann hinterrücks überfallen und übernehmen könnte. Das widerspricht jeder Rationalität, ist aber eine Angst, die viele Menschen in sich tragen. Wovor also hatte ich Angst?
Ich stamme aus einer Welt, in der das Böse zum Alltag gehörte und deshalb verschwiegen werden musste: Mein Vater war kriminell, er saß mehrere Jahre im Gefängnis. Mein Vater war ein klassischer Betrüger – gelernter Antiquar, belesen, talentiert, aber anstatt wertvolle Bücher zu verkaufen, stahl er sie und verkaufte sie teurer weiter. Er zog es vor, in Hotels erfundene Namen anzugeben, anstatt sich mit seiner eigenen Unterschrift zu identifizieren. Im Fernverkehr kaufte er nie Tickets, weshalb ich mich bei der Fahrkartenkontrolle stets schlafend stellen musste – vielleicht meine erste große schauspielerische Herausforderung. Frühzeitig versuchte er, mich in das kriminelle Geschäft einzuführen, indem er mich aufforderte, Bananen auf seine Weise vom Markt zu stehlen: Sie einzustecken, wenn niemand hinsieht, und dann schnell wegzulaufen. Mein Vater war ein Hochstapler, eine Art Felix Krull des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Am Ende starb er vereinsamt in einer dunklen Ecke des Schwarzwaldes. Er, der alle Möglichkeiten gehabt hätte, ein gutes Leben zu führen, entschied sich bewusst dagegen und bewegte sich stattdessen an den Rand der Gesellschaft. Dafür muss man schon eine Menge destruktiven Enthusiasmus und Aggression in sich haben. Aber war er wirklich böse?
Das war der dunkle Fleck meiner Jugend – wir mussten schweigen, nichts erzählen, um nicht mit seinen kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht zu werden. Als Kind einer alleinerziehenden Mutter war die Stigmatisierung ohnehin schon groß. Über meiner Jugend schwebte das große Horrorbild, dass ich genauso werden könnte wie er und am Ende genauso vereinsamt, genauso allein, so beleidigt und resigniert sterben würde – und erst nach zehn Tagen Liegezeit an einem sehr warmen Frühlingsmorgen gefunden werden würde, weil sich die Nachbarn über den Geruch von verwesendem Fleisch beschwert hätten. Mein Vater war ein hochtalentierter Taugenichts – einer, an dessen Schicksal nie er selbst, sondern immer nur die anderen schuld waren.
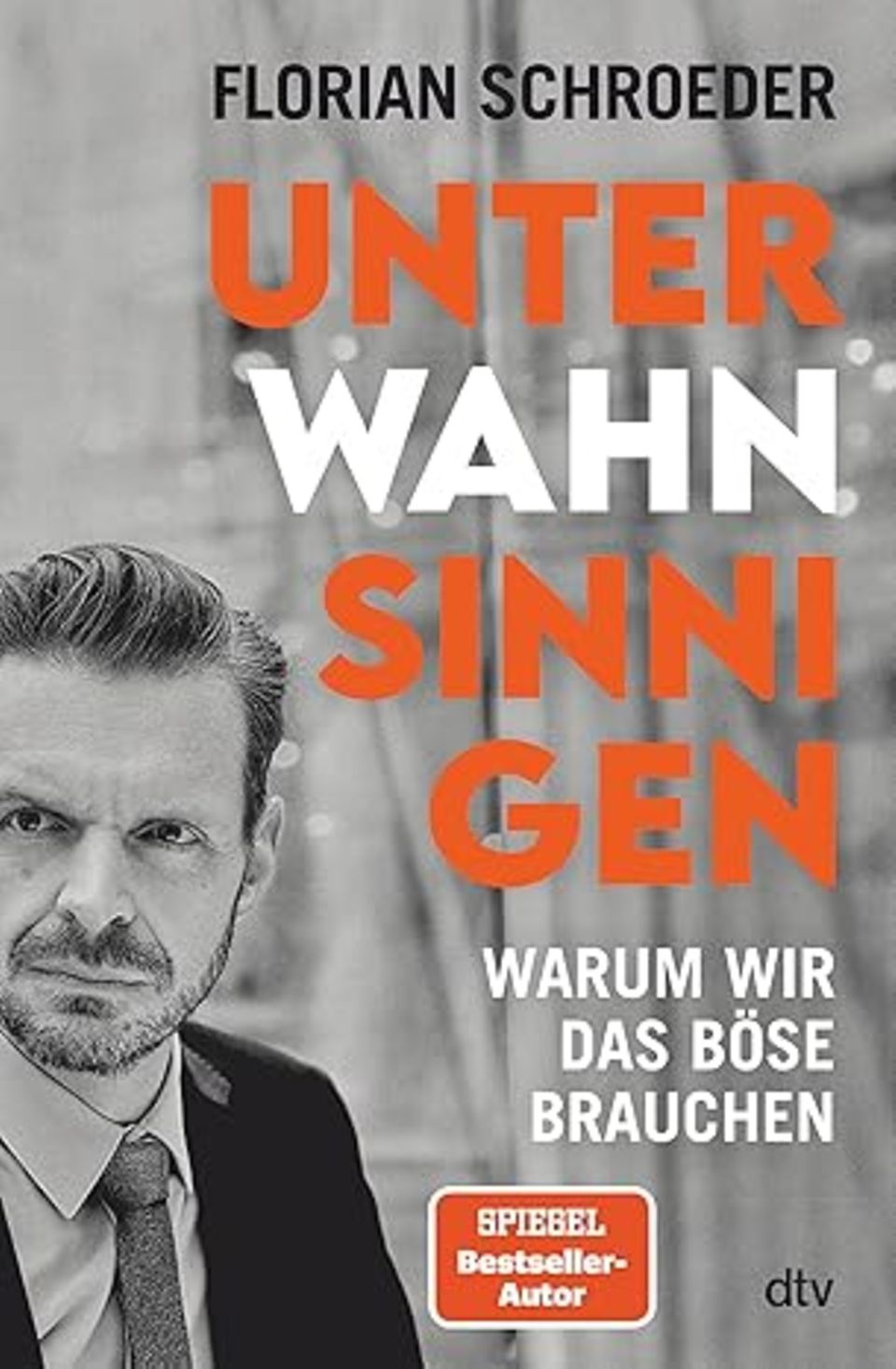
Ich wuchs also mit einem bösen Antihelden auf, und das Lebensziel war bereits erreicht, wenn ich ihm nicht nacheiferte. So erlernte ich auf der einen Seite tatsächlich eine frühe Form der Selbstverantwortung und des Ehrgeizes. Erst viel später erkannte ich, dass das vermeintlich feste und sichere Ufer auf der anderen Seite des Flusses brüchig war und mich nicht vor meinen eigenen Dämonen schützen konnte. Da ich alles, was er war, nur abgespalten und nicht integriert hatte, lebte es weiter und wucherte vor sich hin wie ein Tumor. Deshalb suchte ich mir oft Menschen in meinem Umfeld aus, die das mitbrachten, was ihn ausgemacht hatte. Es waren Figuren der Wiederholung, die die Vergangenheit in der Gegenwart wieder aufleben ließen und mich herausforderten. Oft warfen sie mich in gewohnte Reiz-Reaktions-Schemata zurück. Um all diese Gremlins, die wie Schatten der Vergangenheit im Heute wirkten, abzuwehren, verhielt ich mich wie er – herablassend, arrogant, verletzend, selbstgefällig und kalt, und vor allem externalisierte ich die Schuld. Ich lud also alles zu mir ein, was ich mit so großer Kraft von mir fernhalten wollte. Oftmals gaben die anderen die Schuld.
So kann man sein Leben auch zerstören – trotz der besten Vorsätze und Absichten. Das Bekannte hat immer eine Übermacht, nur weil es vertraut ist. Erst Jahre später, als ich begann, Hegel zu lesen, stieß ich auf einen entscheidenden Satz: "Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt." Dem Bekannten konnten wir blind folgen, uns von ihm leiten lassen oder uns ihm ausliefern – seine Mechanismen hatten wir jedoch nicht verstanden. Das war nur möglich, wenn wir beginnen zu erkennen. Erst in meiner eigenen Psychotherapie, in der ich vor den Trümmern meiner Illusionen stand, habe ich den nächsten Schritt verstanden: Das Erkannte ist noch nicht das Anerkannte. Ich kann Leistungen, Nachweise und Entscheidungen, die mir fremd sind, anerkennen und respektieren. Anerkennen bedeutet, etwas gelten zu lassen, weil es seine Berechtigung hat, unabhängig davon, ob es mir gefällt oder nicht. Anerkennen kann auch bedeuten, das Vergangene dort einzuordnen, wo es seinen Platz hat – dieser Platz muss nicht schön sein, aber angemessen. Ich durfte lernen, auch das Destruktive gelten zu lassen. Wenn es zugelassen ist, muss es sich nicht mehr bemerkbar machen – und ich muss nicht mehr dagegen kämpfen und es größer machen, als es ist. In den ersten Jahren habe ich viele Menschen, die es gut mit mir meinten, gegen mich aufgebracht, weil sie meine besserwisserische Arroganz kaum ertrugen, und ich sah in fast jedem Menschen das Böse, den Feind – auch dort, wo es ihn gar nicht gab. Das kann das eigene Leben ebenfalls zerstören.
Warum erzähle ich diese Geschichte? Warum habe ich mich entschieden, sie öffentlich zu machen? Weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die aus widrigen Umständen stammen, deren Vergangenheit peinlich, schockierend oder zerstörerisch war. Max Frisch, dem oft vorgeworfen wurde, er habe in seinen Büchern nur sich selbst beschrieben, sagte einmal: "Ich lebe nicht mit der eigenen Geschichte." Das ist ein dramatischer Satz. In einer Zeit, in der so viel über Identität gesprochen wird, über den angeblichen Verlust von Grenzen und die Bedrohung des Eigenen durch das Fremde, können wir im Eigenen, nicht im Fremden, einen Anfang machen: Herr über die eigene Geschichte zu sein, eine Art Ich und Identität auch auf unsicherem Boden zu gründen.
Frage nach Gut und Böse erscheint in neuem Licht
In diesen Tagen, in denen sich das Gefühl breitmacht, dass das Schicksal der Welt in nur wenigen Kilometern zwischen Israel und dem Gaza-Streifen entschieden wird, erscheint die Frage nach Gut und Böse in einem neuen Licht. Der wieder aufgeflammte Krieg im Nahen Osten zeigt die Weltkonflikte wie unter einer Lupe: Demokratie gegen Diktatur, Juden gegen Araber, Orient gegen Okzident – und vor allem Täter gegen Opfer. Es ist erstaunlich und beängstigend, wie Menschen in ganz Europa, die sich normalerweise für LGBTQ+ engagieren, plötzlich palästinensische Fahnen schwenken und genau wissen, wer die wahren Opfer sind."








