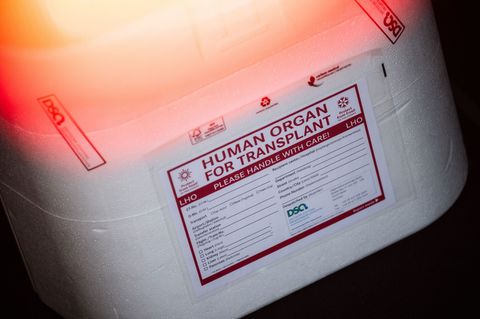Das Klischee ist quicklebendig: Italien, das ist das "Land der Bambini". Alles dreht sich um die Kleinen: Die sitzen wie selbstverständlich bis spätnachts mit ihren Eltern im Restaurant. "Mamma" zu sein, ist der große Traum aller Frauen. Und am Sonntag versammelt sich die ganze Sippschaft am Mittagstisch, um lachend und genussvoll Pasta zu verspeisen. Deutsche mögen das Stereotyp ganz besonders: Die Italiener und ihre Kinder, das erwärmt das Herz.
Und irgendwie stimmt es ja noch, das schöne Bild von der heilen Welt: Wo immer die Kleinen auf der Piazza erscheinen, brechen die Erwachsenen in Schreie der Bewunderung aus. Kein Wunsch nach einem Gelato wird ihnen verwehrt, und für Nonna und Nonno, für Oma und Opa, ist das Nipotino, das Enkelchen, der Traum vom Glück. Der einzige Haken dabei ist, dass die Kinder zunehmend ausbleiben: Statt Großfamilie und fröhlich lärmender Kinderschar ist heute das Einzelkind zur Regel geworden - verwöhnt, verhätschelt, verzogen.
Ein Kind pro Familie
"Das ist die vielleicht folgenreichste Konsequenz der Kinderarmut in Italien", meint die deutsche Psychologin Brigitte Stübner- Landricina in Rom. "Da lernt der Sprössling gar nichts anderes kennen als Hauptperson zu sein." Vor allem die Besserverdienenden lassen es dem Nachwuchs an nichts fehlen: Seit neustem gibt es Mopeds, die zu Mini-Autos umgebaut werden. Die kriegen Jungen wie Mädchen schon mit 14 Jahren, mit 18 folgt der Alfa. Wer es sich leisten kann, schenkt seinen Kindern eine Eigentumswohnung - wenn irgend möglich nur ein paar Schritte vom Elternhaus entfernt. "Man hat heute wenig Kinder, die Zeit mit ihnen will man total genießen", erklärt die Expertin den Trend zur Großzügigkeit.
Statistisch gesehen bekommt eine Italienerin heute 1,33 Kinder, die Geburtenrate ist damit sogar noch geringer als in Deutschland (1,36). Und das trotz traditioneller Kinderliebe und der Macht der katholischen Kirche in Italien, die den "Schutz der Familie" immer mehr zum Topthema macht. Zwar lag die Quote vor ein paar Jahren schon einmal marginal tiefer und Optimisten hoffen sogar auf so etwas wie eine "Trendwende" - doch die ist nicht in Sicht. Pessimisten gehen davon aus, dass es im Jahr 2050 in Italien wieder so viele Einwohner geben wird wie in den 50er Jahren. Das wären 45 Millionen, 12 Millionen weniger als im Jahr 2002.
Zu wenig Geld für die Infrastruktur
Dabei gibt es sogar eine relativ großzügige Mutterschaftsregelung in Italien: Berufstätige Frauen können fünf Monate zu Hause bleiben. Junge Mütter kriegen am Arbeitsplatz zwei Mal täglich eine Stunde frei. Wer will, kann in den ersten acht Lebensjahren des Kindes zehn Monate frei machen - mit 30 Prozent des Einkommens. Doch was fehlt, ist die Infrastruktur: Kinderkrippen, Horte, Kindergärten. "In der Familienpolitik hinkt Italien hinterher", kritisiert eine Zeitung.
Italien gebe viel weniger Geld für Familien aus als die anderen EU-Länder, stellt das Forschungsinstitut Eurispes fest. Eine weitere Ursache für die Kinderarmut sei die wirtschaftliche prekäre Lage: Immer mehr Arbeitnehmer müssen mit 1000 Euro im Monat auskommen, immer mehr junge Leute sind gezwungen, bei den Eltern zu wohnen, immer weniger Paare können sich Kinder leisten. Dass Kinderarmut wirtschaftliche Gründe hat, belegt auch der neueste Trend: Im Mezzogiorno, dem wirtschaftlich rückständigen Süditalien, werden jetzt sogar weniger Kinder geboren als im Norden. Bisher konnten Optimisten noch hoffen, wenigstens im Süden sei das traditionelle Kinder-Idyll noch intakt.