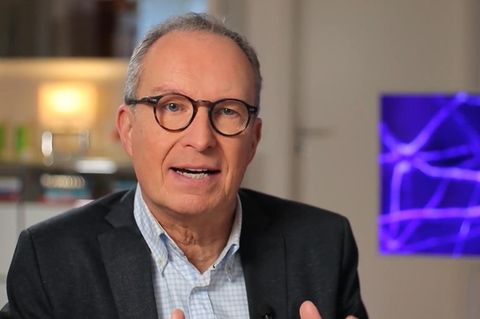Das kleine Mädchen hat dunkle Haare und Ärmchen, die nicht viel dicker sind als der Daumen eines kräftigen Mannes. Ihre winzigen Finger sind fast durchscheinend, ein dünner Schlauch, mit einem weißen Pflaster befestigt, führt in ihre Nase. "Sie ist schon so gewachsen", sagt Ewa Maria R., 38, und streicht ihrer Tochter über den Kopf, "mein kleines Wunder".
Das kleine Wunder heißt Marusia und wiegt 2324 Gramm. Noch heute ist Marusia kleiner und leichter als andere Kinder bei der Geburt - dabei ist sie nun schon vier Monate alt. Als Marusia zur Welt kam, 32 Zentimeter, 780 Gramm, war Ewa Maria R. in der 25. Schwangerschaftswoche. Und hinter ihr lagen bereits Wochen der Angst.
Seit der 20. Schwangerschaftswoche lag R. auf der Pränatalstation im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), in der 22. Woche öffnete sich der Gebärmuttermund und die Fruchtblase rutschte nach unten. "Wir wussten lange nicht, ob dieses kleine Mädchen früher geht oder ob es eine Chance bekommt", sagt R. Auf die Frage, ob Marusia ihr erstes Kind sei, hat sie geantwortet: "Sie ist das erste, das lebt." Ein schlichter Satz, der nur ahnen lässt, welch schwierige Zeit hinter ihr liegt.
Schweineflüssigkeit gegen den Erstickungstod
Marusia kam dreieinhalb Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. Erst dank der Fortschritte in der Medizin haben so extrem früh geborene Kinder eine Chance - vor einem Vierteljahrhundert noch wäre das kleine Mädchen dem Tode geweiht gewesen. Bereits ab der 23. Schwangerschaftswoche ist inzwischen ein Überleben außerhalb der Gebärmutter möglich. "Dieser Zeitpunkt markiert die Grenze der Lebensfähigkeit", sagt Kinderarzt Dominique Singer, Leiter der Neugeborenen- und Kinderintensivmedizin am UKE. "Vorher haben die Föten noch keine echten Lungenbläschen - die Lunge ist beim Menschen das Organ, das als letztes fertig wird."
Kommen Kinder vor der 30. Woche zur Welt, haben sich ihre Lungenbläschen noch nicht entfaltet - "Lungenunreife" nennt man das. Ihre Lunge produziert noch kein Surfactant - die weißliche Flüssigkeit verhindert, dass die Bläschen zusammenfallen. Früher sind sehr kleine Frühgeborene an ihrem Atemnotsyndrom erstickt, wenn sie nicht massiv beatmet wurden. Heute behelfen sich die Kinderärzte mit einem Trick: "Wir geben Surfactant vom Schwein oder Rind über den Beatmungsschlauch in die Lunge, dann überleben sie", sagt Singer.
Vorerst zumindest - denn für Ärzte und Eltern ist das Hoffen und Bangen um das junge Leben damit noch lange nicht vorbei. "Die Anfangszeit für mich als Mutter war voller Sorge und Angst, wie es diesem Mini-Menschlein geht. Die ständige Anwesenheit des Todes, das Nicht-Wissen, was wird - das auszuhalten ist eine große Herausforderung", sagt Ewa Maria R.
Angst vor Lähmungen und vorm Wasserkopf
Tausend Sorgen plagen die Eltern der Frühchen: Hält das kleine Herz durch? Schafft der Darm die Arbeit, für die er eigentlich noch gar nicht weit genug entwickelt ist? Besonders gefürchtet: Hirnblutungen - Lähmungen oder ein Wasserkopf können die Folge sein.
1500 Kinder kommen jedes Jahr am UKE zur Welt, 60 von ihnen wiegen weniger als 1500 Gramm. Es sind diese "sehr unreifen Frühgeborenen", wie Dominique Singer sagt, die der meisten Zuwendung bedürfen. Doch auch wenn heute weit mehr Frühgeborene überleben als noch vor einigen Jahren: Weitgehend unverändert ist der Prozentsatz der Kinder, die mit spürbaren Behinderungen zur Welt kommen: mit Lähmungen, taub oder blind. "Das scheint der Preis zu sein, den wir für die Frühgeburtlichkeit zahlen müssen", sagt Singer.
Voll verkabelt - zur eigenen Sicherheit
Dabei haben die Ärzte viel gelernt in den letzten Jahren. Etwa, dass zu viel Sauerstoff Lunge und Augen der Kinder angreifen kann. Früher sind viele Frühgeborene erblindet - heute geschieht das kaum noch. "Man hat festgestellt, dass man sie nicht so lange künstlich beatmen muss, wie man früher dachte", sagt Singer.

Stattdessen bekommen die Neugeborenen einen Stecker in die Nase, über den ihnen Frischluft in den Rachen geblasen wird, um ihnen das Atmen zu erleichtern - CPAP nennt man das, kurz für Continuous Positive Airway Pressure (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck). Auch Marusia hatte über mehrere Wochen einen solchen CPAP in der Nase. Heute kleben an ihrem Körper noch drei dünne Kabel, rot, grün, gelb, die Herzfrequenz und Atmung überwachen, und ein etwas breiteres blaues, das die Sauerstoffsättigung kontrolliert.
Kabel, Apparate, Angst: Vielen Eltern fällt es schwer, in der fremden, sterilen Klinikumgebung einen innigen Kontakt zu ihrem Kind aufzubauen - auch wenn die Wände der Frühchen-Intensivstation mit bunten Blumen dekoriert sind und Eltern eigene Kinderwäsche mitbringen dürfen.
Kleines Leben hinter der Scheibe
Bis zum errechneten Geburtstermin bleiben die Frühchen gewöhnlich im Krankenhaus. "Eine kolossale psychische Belastung für die Eltern", sagt Singer. Trotzdem gibt es so etwas wie Alltag auf der Frühchen-Intensivstation im Hamburger UKE. Jeden Morgen kommen die Mütter, sie verbringen den ganzen Tag mit den Frühgeborenen, stehen vor den Brutkästen, schauen durch die Scheibe auf das kleine Leben, das dort heranwächst.
Wenn sie etwa eine Woche alt sind, dürfen die Kinder zum ersten Mal aus dem Brutkasten und sich an die Brust der Mutter kuscheln. "Ein unbeschreibliches Gefühl", sagt Ewa Maria R. Känguru-Methode nennen es Ärzte, wenn sie der Mutter oder dem Vater das Frühchen auf die Brust legen und gut zudecken - Körperkontakt pur. "Das tut Eltern und Kind gut", sagt Singer, "viele Kinder sind im Brutkasten unruhig und zappelig, auf der Brust der Mutter werden sie ruhiger." Die Väter kommen meist erst abends in die Station, sie müssen arbeiten. Wenn das Kind endlich nach Hause darf, liegen hinter den Eltern Monate im Ausnahmezustand.
Die Frühchen kommen mit einer Hypothek zur Welt
Doch auch später können immer wieder neue Probleme auftreten: Die Kinder werden nicht sauber, können sich schwer konzentrieren oder fallen in der Schule zurück. "Frühgeborene bringen eine Hypothek mit: Ihre Hirnentwicklung ist noch nicht abgeschlossen, wenn sie zur Welt kommen - daher brauchen sie ein förderndes Umfeld. Für die Eltern ist das über Jahre hinweg eine große Herausforderung", sagt Singer. Er fordert deshalb: "Die Patienten brauchen Begleitung über die gesamte Kindheit hinweg."
Sparschaltung fürs Leben, im Mutterleib programmiert
Ein besonderer Fall sind die Föten, die im Mutterleib nicht mehr ausreichend wachsen. Laut Singer ein Hinweis auf eine Mangelversorgung: "Der Körper des ungeborenen Kindes schaltet auf Sparflamme: Es wächst nicht, kann aber überleben." Um bleibende Entwicklungsschäden zu verhindern, holen Ärzte solche Kinder vorzeitig per Kaiserschnitt auf die Welt.
Diesen Kindern drohen im späteren Leben unerwartete Probleme. Klein geboren, holen sie den Wachstumsrückstand oft nicht mehr komplett auf. Später neigen sie zum metabolischen Syndrom, dem tödlichen Quartett aus Übergewicht, hohem Blutdruck, Fett- und Zuckerstoffwechselstörungen, dass das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle in die Höhe schnellen lässt. "Sie haben im Mutterleib eine Sparschaltung erlebt, die sie nie mehr ganz loswerden: Ein normales Angebot wirkt bei ihnen wie ein Überangebot", erklärt Singer.
Sorgen, die für Ewa Maria R. weit weg sind. Für sie zählt jetzt erst einmal nur eins: Dass ihre Tochter am Leben ist und gesund und dass nach den Monaten des Hoffens und Bangens so etwas wie Alltag eingekehrt ist. Ihre Bilanz der vergangenen Monate: "Im Nachhinein gesehen war es eine sehr intensive Zeit. Man denkt, dass man es nicht länger aushält - und doch tut man das." Das kleine Wunder auf ihrem Arm ist von diesen Worten denkbar unbeeindruckt: Es kuschelt sich fest an Mamas Brust, schließt die Augen und schläft ein.