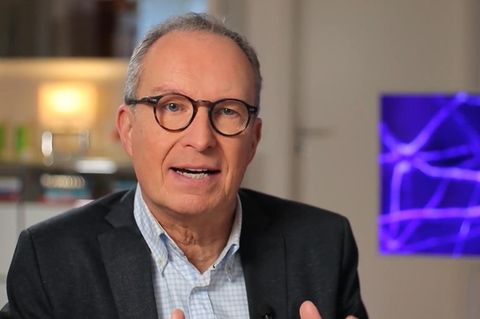Vor beinahe 200 Jahren fand eine bis dahin nicht genau erforschte Schüttellähmung ihren Namensgeber: Der englische Arzt James Parkinson verfasste eine wissenschaftliche Beschreibung der "inoffiziell" seit Langem bekannten Erkrankung. "Unabsichtliche Zitterbewegungen, Muskelschwächung, Neigung, den Rumpf vorzubeugen und vom Gehen in plötzliches Hasten zu verfallen. Sinne und Intellekt sind nicht betroffen" - so charakterisierte Parkinson das Leiden. Etwa 1,4 Prozent der 55-Jährigen sind befallen, 3,4 Prozent der 75-Jährigen. Männer trifft es etwas häufiger als Frauen. Oft beginnt es mit Gliederschmerzen, innerhalb weniger Jahre stellt sich jedoch das typische Krankheitsbild ein: Zittern, Verlangsamung von Bewegungen, Unfähigkeit, willentliche Bewegungen kraftvoll auszuführen, monotones Sprechen, Ausbildung eines starren Maskengesichts. Sehr oft wird die Parkinsonsche Krankheit von depressiven Verstimmungen begleitet.
Ursache von Parkinson ist die fortschreitende Zerstörung jener Nervenzellen, die dem Gehirn den Botenstoff Dopamin zur Verfügung stellen. Er ist für die zentrale Bewegungskoordination nötig. Eine Vielzahl von Medikamenten kann das Leid der Patienten zunächst lindern. Sie sorgen dafür, dass ausreichend Dopamin an den Nervenzellen vorhanden ist. Allerdings können Arzneien das Fortschreiten der Krankheit nicht aufhalten: In den ersten sechs bis acht Jahren kommen die Patienten mit der Behandlung gut zurecht und spüren nicht viel von ihrer Erkrankung. Dann aber wird es zusehends schwieriger, die Symptome zu unterdrücken. Manche Parkinsonkranke wagen darum eine Operation, bei der entweder bestimmte Nervenleitungen gekappt oder Elektroden ins Gehirn eingepflanzt werden. Zusätzlich können die Patienten versuchen, den Verlauf ihrer Erkrankung mittels Physiotherapie und Gedächtnisübungen zu bremsen. Eine Heilung der Parkinsonkrankheit - zum Beispiel mithilfe von Stammzellen - ist noch nicht möglich.
Christoph Koch, Astrid Viciano