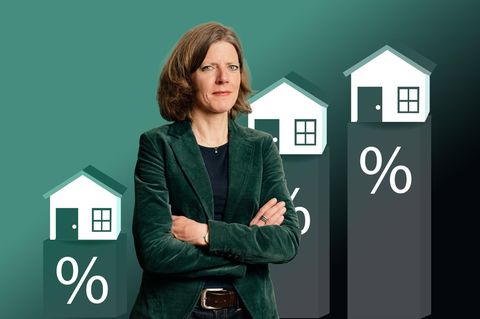Wenn ab 2009 die Rentenversicherer erstmals ihre Daten direkt an die Finanzämter übermitteln werden, kommt auf geschätzte zehn Prozent der knapp 20 Millionen Rentner Ärger mit dem Finanzamt zu: Denn dann werden die Finanzämter bei voraussichtlich zwei Millionen Ruheständlern rückwirkend Steuern nachfordern. Zwar haben diese säumigen Zahler meist nicht bewusst Steuern hinterzogen, sondern wohl schlicht aus Unwissenheit nicht gezahlt. Dieser Irrtum könnte sie aber teuer zu stehen kommen.
Ab 2040 ist jeder Renteneuro steuerpflichtig
Grund für das Interesse der Finanzämter ist die breitere Besteuerung der Renten, die seit dem Start des Alterseinkünftegesetzes 2005 jetzt schrittweise greift. Damals wurde der zu versteuernde Teil der Rente für Altrentner von 27 auf 50 Prozent erhöht, für Neurentner steigt er seit 2006 mit jedem Jahrgang um weitere zwei Punkte. Im Gegenzug dürfen Erwerbstätige im gleichen Ausmaß ihre Aufwendungen für die Altersvorsorge von der Steuer absetzen.
Etwa jeder dritte der 15 Millionen Rentnerhaushalte müsste also laut Angaben der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG) Steuern zahlen, bisher tun dies aber nur 3,4 Millionen. Da die Steuerfahndung in der Bundesrepublik Ländersache ist, sind die dortigen Finanzämter über die kommende Mehrarbeit nicht erfreut - auch wenn der DStG nur von kleineren Beträgen ausgeht. Unangenehm ist eine Auseinabersetzung mit dem Finanzamt aber allemal - und teuer kann sie auch noch werden. Deshalb erkläre wir, wer alles von der Steuerpflicht betroffen ist - und was man tun kann, wenn man ins Visier des Finanzamts geraten ist.
Warum sind Rentner plötzlich Steuerzahler?
Was die meisten Rentner noch aus ihrer steuerpflichtigen Erwerbskarriere kennen, begleitet sie nun auch im Ruhestand. Denn mit dem Start des Alterseinkünftegesetzes wurde das bisherige Steuersystem einschneidend verändert: Ab dem 1.1.2005 hat der Einstieg in die sogenannte nachgelagerte Besteuerung begonnen. Von den Altersrenten wird dann einheitlich ein Anteil von 50 Prozent steuerpflichtig. Für jeden hinzukommenden Rentenjahrgang wird dieser Besteuerungsanteil bis zum Jahr 2020 zunächst um jeweils zwei Prozent, vom 1.1.2021 um jeweils ein Prozent erhöht. Im Jahr 2040 wird dann auf die volle Rente Steuern erhoben.
Maßgebend für die Höhe der Steuer ist der individuelle Steuersatz. Deshalb dürften bald alle jene Rentner Probleme bekommen, die Nebeneinkünfte wie Privat- oder Betriebsrenten und Zins- oder Mieteinnahmen - absichtlich oder unabsichtlich - nicht angegeben haben. Dann drohen Nachzahlungen oder Strafverfahren.
Derzeit gilt: Fast 70 Prozent der gut 20,3 Millionen Ruheständler bleiben vom Zugriff des Fiskus verschont. Wer also eine kleine Rente bekommt, darf sich relativ sicher fühlen.
Wer ist betroffen?
2005 zahlten erst rund zwei Millionen Ruheständler Steuern. Die große Masse blieb unter der steuerlichen Freigrenze. Der Fiskus schlägt erst bei einer Überschreitung des jährlichen Grundfreibetrages von 7664 Euro (Ehepaar: 15.328 Euro) zu. Je höher der Anteil des zu versteuernden Renteneinkommens ist, desto mehr wird aber auch die Gruppe der Betroffenen wachsen. Steuern zahlen müssen damit all' jene, die eine hohe gesetzliche Rente beziehen oder deren Ehepartner noch arbeitet. Zur Kasse gebeten wird aber auch, wer eine niedrigere gesetzliche Rente hat plus Zusatzeinkommen wie eine Betriebs- oder Privatrente, Miet- oder Kapitaleinkünfte (Zinsen, Dividenden). Auch die Witwenrente ist wie die Altersrente zum selbem Prozentanteil steuerpflichtig.
Es trifft Rentner mit mehreren Einnahmequellen
Die Steuerpflicht kann also vor allem Senioren treffen, deren Einkünfte sich aus mehreren Quellen speisen. In solchen Fällen heißt es zusammenrechnen. Beispiel: Eine allein stehende Rentnerin bekommt im Monat 1100 Euro Rente inklusive Witwenrente, 200 Euro Betriebsrente und 300 Euro Zinsen. Damit musste sie bereits 2005 erstmals Steuern zahlen.
Im Schnitt müssten steuerpflichtige Seniorenhaushalte etwa 500 Euro an den Fiskus abführen, so die Einschätzung des Bundesfinanzministeriums.
Welche Schlupflöcher gibt es?
Vorläufig bieten Freibeträge ein Schlupfloch. Ein allein stehender Rentner mit 1000 Euro monatlich muss laut Finanzministerium keine Steuern zahlen. Als Faustregel gilt: Die Grenze liegt bei 1575 Euro Bruttorente im Monat, für Ehepaare bei 3150 Euro. Erst ab etwa dieser Höhe wird (nach Abzügen) der steuerfreie Grundfreibetrag pro Jahr von 7664 Euro (Ehepaare: 15.328) überschritten.
Wenigstens können die betroffenen Ruheständler auch etwas absetzen. Zum Beispiel 102 Euro pauschal für Werbungskosten wie Büromaterial. Oder Zahlungen in die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge zur Unfall-, Privathaftpflicht-, KfZ-Versicherung sowie Aufwendungen wegen Behinderung, für Pflege oder Hinterbliebene.
Auf welche Daten greift der Fiskus zu?
Bisher fielen Ungereimtheiten oder gezielte Mogeleien nicht weiter auf. Renten und Nebeneinkünfte wurden nicht zentral erfasst. Das hat sich nun geändert. Denn die Rentenkassen, Versorgungswerke und auch die privaten Versicherer müssen ihre Überweisungen an Ruheständler nun jährlich melden. Diese Daten werden elektronisch an die Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen gemeldet, die bei der Deutschen Rentenversicherung angesiedelt ist. Nach einer Vorauswahl gehen die entsprechenden Daten dann weiter an die Finanzämter.
Das Kontrollnetz wird enger
Dadurch stehen nun jene Rentner stärker im Visier, die in den Vorjahren keine Steuererklärung einreichten, es jetzt aber durch das Alterseinkünftegesetz tun müssen. Da wird Nachbohren manchmal nicht zu vermeiden sein, denn der Fiskus darf auch die Einnahmen der Vorjahre unter die Lupe nehmen - und das bis zu zehn Jahre zurück.
Hinzu kommt, dass Banken neuerdings Jahresbescheinigungen über Kapitaleinkünfte und Wertpapiergeschäfte ausstellen müssen, angefangen mit 2004. Gleichzeitig dürfen die Finanzämter die Stammdaten privater Konten im Inland abfragen. Selbst Schwarzgeldkonten und andere Einnahmequellen im Ausland werden transparenter. Ab Mitte 2005 greift außerdem die EU-Zinsrichtlinie. Damit werden die Kapitaleinkünfte Deutscher in den meisten Ländern der Europäischen Union (EU) an den Fiskus daheim gemeldet. All das macht auch die Einkünfte von Rentnern auf einen Schlag so durchsichtig wie nie zuvor.
Was sollten Rentern tun?
Das Kontrollsystem greift erst ab 2007 so richtig - aber dafür rückwirkend ab 2005. Rentner, die also Probleme mit dem Fiskus befürchten, sollten ihre steuerliche Situation rechtzeitig mit einem Steuerberater besprechen. In "einfacheren" Fällen könnte auch der Lohnsteuerhilfeverein helfen. Rentner können aber auch gleich den Mantelbogen der Steuererklärung mit der Anlage R ausfüllen und dort ihre Einnahmen auflisten. Alles Weitere erledigt dann das Finanzamt.
Still halten oder gar schummeln nutzt nichts: Wer Zusätze wie Betriebsrenten, Mieten, Zinsen oder Privatrenten verschweigt, dürfte bald auffliegen. Das gilt auch für Ruheständler, die wegen hoher Gesamteinkünfte schon früher hätten Steuern zahlen müssen. Denn die Finanzämter haben seit 2005 bestens Einblick in die Einkünfte aller Rentner in Deutschland - und die seit Anfang August ausgegebene bundeseinheitliche Steuernummer vereinfacht das noch zusätzlich.
(siehe auch Artikel "Der Fiskus erkennt Sie nun noch besser")
Was passiert, wenn man sich nicht kümmert?
Wer sich nicht kümmmert, dem können Nachzahlungen und Ärger ins Haus stehen. Dieser ist deshalb quasi programmiert, weil auch bloß unwissentlich verschwiegene Einkünfte nicht vor einem Steuerstrafverfahren schützen. Nähere Auskünfte über eine mögliche Steuerpflicht geben Lohnsteuerhilfevereine, Steuerberater und auch das zuständige Finanzamt. Der Beratungsbedarf scheint sich bislang allerdings noch in Grenzen zu halten.
Tipps zur Steuererklärung
Um Rentnern beim Ausfüllen der aktuellen Steuererklärung zu helfen, hat der Steuerzahlerbund Hessen einen Ratgeber zusammengestellt. Das Werk "Steuererklärung für Senioren" kann im Internet unter www.steuerzahler-hessen.de heruntergeladen werden. Der Ratgeber enthält Informationen über die auszufüllenden Formulare sowie die Abzugsmöglichkeiten von Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Ein Kapitel befasst sich zudem mit Zinseinkünften.