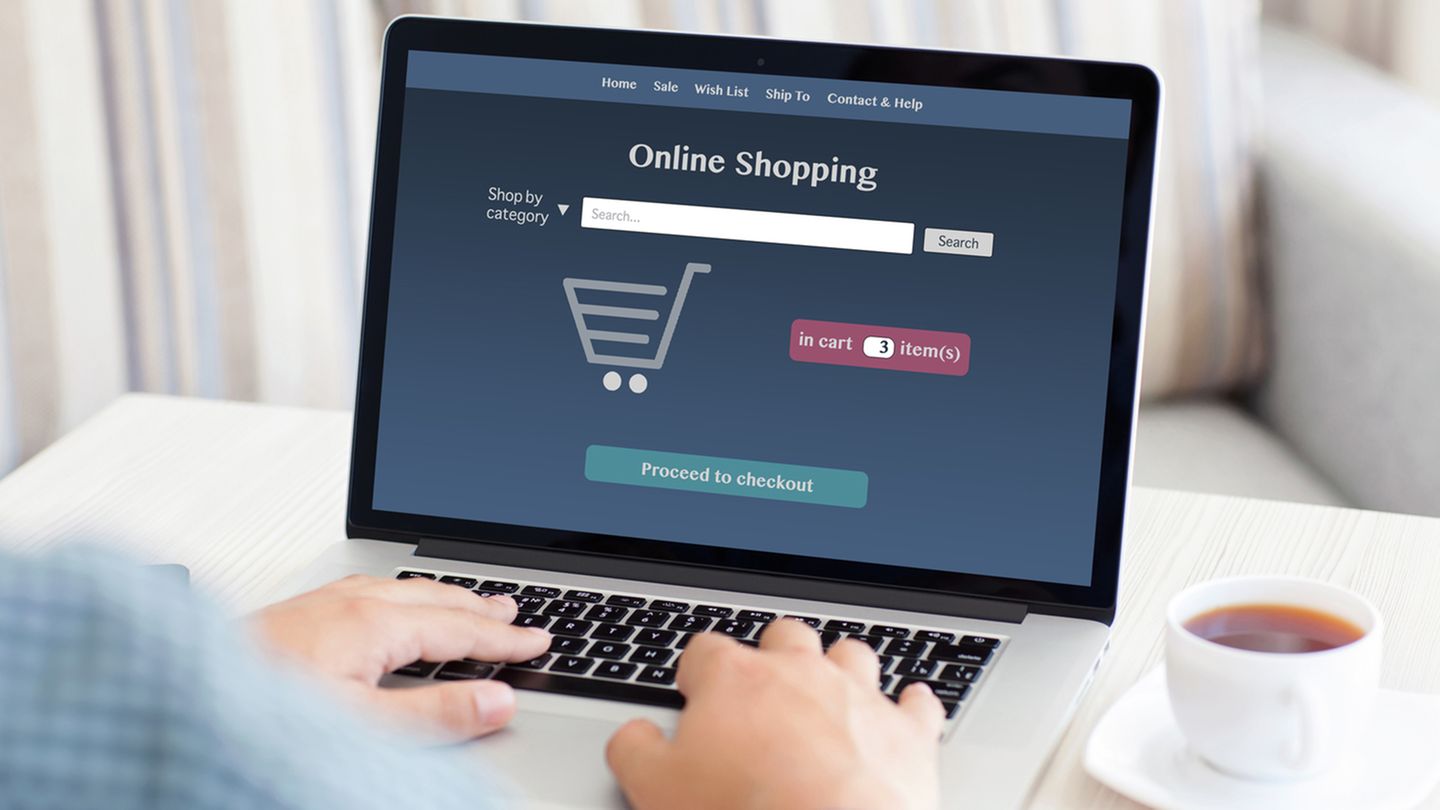Mark-Thomas E. war ein Geschäftsmann der besonderen Art. Über 21 Onlineshops verkaufte der Münchener 750 populäre Produkte wie Kaffeemaschinen, Handys und Spielekonsolen. Geliefert hat er keinen einzigen Artikel - abkassiert dagegen schon. Rund 440.000 Euro soll der 35-Jährige mit seinen Fake-Shops verdient haben. Derzeit wird ihm vor dem Landgericht München der Prozess gemacht. Der Angeklagte hat die Taten gestanden, die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von mindestens sieben Jahren.
"Die Masche funktioniert leider immer wieder", sagt Oberstaatsanwalt Matthias Huber von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, die den Fall übernommen hat, im Gespräch mit dem stern. "Das Problem ist seit Jahren bekannt, taucht aber in verschiedenen Formen immer wieder auf." Betrügerische Fake-Shops im Netz haben Konjunktur und weil das so ist, hat Hubers Behörde vor zwei Jahren die Zentralstelle Cybercrime Bayern gegründet.
Finanzagenten und andere Strohmänner
Die fünf Staatsanwälte der Bamberger Spezialeinheit ermitteln bayernweit bei schweren Fällen von Cyberkriminalität. Darunter fallen Hackerangriffe, illegaler Waffen- und Drogenhandel im Darknet sowie eben der Betrug mit Fake-Shops. Auch andere Bundesländer haben in den vergangenen Jahren solche Cybercrime-Einheiten gebildet. Allein die bayerischen Cybercrimejäger leiteten im vergangenen Jahr 1545 Ermittlungsverfahren ein. Dazu kommen noch all die kleineren Fälle, die bei den ganz normalen Staatsanwaltschaften auflaufen.
Das größte Problem der Ermittler: Die Identität der Täter ist meist nur schwer zu ermitteln. "Viele Betrüger agieren über Finanzagenten und andere Strohmänner", sagt Oberstaatsanwalt Huber. Um die Identität zu verschleiern, werben viele Betrüger gezielt Leute an, die ihr Konto für die Geschäfte zur Verfügung stellen, berichtet Huber. Die bekommen dann 500 Euro und stellen keine Fragen. Fliegt der Strohmann auf, wird eben ein neuer angeheuert. Manche professionelle Betrüger greifen auf ein ganzes Netzwerk an Mittelsmännern zurück. Auch Geldtransfers über Dienstleister wie Western Union sind ein beliebtes Mittel. "Solange es funktioniert, wird es das immer wieder geben", sagt Huber.
Selbst auf Amazon müssen Kunden auf der Hut sein. Der Onlineriese hat seit geraumer Zeit mit Drittanbietern zu kämpfen, die auf der Plattform mit Fake-Shops Kunden ködern. Der Trick dabei: Die Betrüger drängen die Kunden dazu, nicht den Amazon-Warenkorb zu nutzen, sondern das Geschäft außerhalb der Amazon-Kontrolle per Mail abzuschließen. Natürlich mit Vorkasse.

Vorsicht bei Vorkasse!
Huber empfiehlt Verbrauchern, niemals bei Anbietern, die man nicht kennt, in Vorkasse zu gehen. Auch wenn Produkte deutlich unter Marktpreis angeboten werden, sollten beim Online-Shopping die Alarmglocken angehen. "Wenn der Fernseher überall 1000 Euro kostet, nur einer hat ihn für 500 Euro, sollte man misstrauisch werden", sagt Huber. Wie man Fake-Shops noch erkennen kann, hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen in einer übersichtlichen Broschüre zusammengestellt.
Auf gewerbsmäßigen Betrug steht für jeden einzelnen Betrugsfall ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahren Gefängnis. Die Chancen der Opfer, Geld wieder zu bekommen, seien aber meistens gering, berichtet Huber. Denn: Selbst wenn ein Täter ausfindig gemacht wird, ist das Geld oft schon weg.
Auch die Opfer von Mark-Thomas E. können sich nur wenig Hoffnung machen. Der Angeklagte hat vor Gericht beteuert, der Großteil des Geldes sei an einen Komplizen gegangen. Er selbst habe nur 20.000 bis 30.000 Euro abbekommen und bereits alles "versoffen und verkokst", wie die Süddeutsche Zeitung aus dem Gerichtssaal berichtet. Kommende Woche wird der Prozess fortgesetzt.