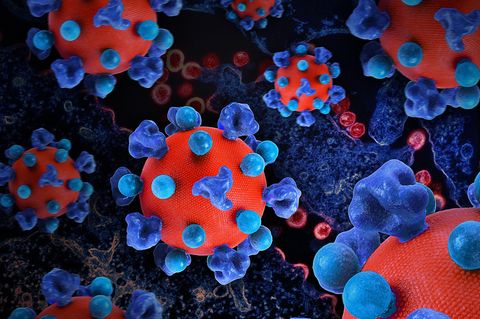Das kurze rötliche Haar trägt Ken Meeks ordentlich gescheitelt. Ein roter Vollbart rahmt sein mageres, fleckig-blasses Gesicht mit den tief liegenden Augen. Der Mund ist geöffnet, der Blick erschöpft. Schwarze Flecken - Läsionen - zeichnen den dürren Oberarm, der aus dem nicht Krankenhausnachthemd schaut. Meeks sitzt im Rollstuhl, im Hintergrund ist das Wohnzimmer seines Hauses in San Francisco zu erkennen. Drei Tage nach der Aufnahme im September 1986 ist Meeks tot, gestorben an Aids.
Meeks ist eines von vielen Opfern der Anfang der 80er von Medizinern als "gay related" ("schwulenbezogen") beschriebenen Immunschwäche. Tatsächlich sind viele Betroffene homosexuell. Die Hintergründe und Zusammenhänge der bislang unbekannten Krankheit geben Wissenschaftlern Rätsel auf. Angst und Vorurteile prägen die öffentliche Wahrnehmung der Erkrankung, die viele zunächst als Randgruppenproblem sehen, einige sogar als "gerechte Strafe" für "Schwuchteln" und Junkies.
Die menschliche Dimension der nahenden Epidemie wird von den meisten verkannt - bis Alon Reininger sie greifbar macht. "Ich wollte nicht nur eine Geschichte über Ken Meeks machen", sagt der Fotojournalist. "Ken war eine Figur in einer größeren Geschichte. Er wusste, dass ich sein Bild in einem Gesamtzusammenhang machte. Aber zufällig habe ich ihn in einer bestimmten Situation fotografiert, die bei vielen Leuten einen Nerv getroffen hat."
Der Begriff "Schwulenepidemie" prägt die Medienberichterstattung der ersten Jahre, selbst in seriösen Zeitungen wie der "New York Times". Bald tritt die religiöse Rechte auf den Plan, die von der "Strafe Gottes" spricht. Orthodoxe Juden, Abtreibungsgegner und Konservative stoßen ins gleiche Horn. Die schwule Gemeinschaft, die schon seit Jahren um Freiheit und Akzeptanz kämpft, soll nun ihre Existenz an sich rechtfertigen. Ein herrscht ein Klima der Hexenjagd. "Schwule führten damals noch immer ein Doppelleben", so Reininger. "Es gab schwule Manager an der Wall Street, die an Aids erkrankten und Ausreden finden mussten, warum sie so oft zum Arzt mussten. Es gab kein Verständnis für sie."
Es ist vor allem seine einfühlsame und ausführliche Reportage über Aids, die Reininger bekannt macht. Sein Porträt des schwer kranken Ken Meeks wird Pressefoto des Jahres 1986 und erhält zahlreiche weitere Auszeichnungen. Zugleich überlagert die engagierte Bildserie das umfassende Werk des 1947 in Tel Aviv geborenen Fotojournalisten, der seine Karriere als Reporter der amerikanischen Nachrichtenagentur UPI im Jom Kippur Krieg zwischen Israel, Ägypten und Syrien 1973 begann. Politische Unruhen von Südafrika bis China und soziale Themen wie Armut, Einwanderung oder Bildung erkundet er mit scharfer Beobachtungsgabe und viel Engagement. Alon Reininger ist einer, der sich Zeit nimmt, in die Tiefe geht. Einer, der das große Ganze zeigen will. Reininger, das ist aber auch - wie die Fachzeitschrift "American Photo" formuliert, ein "unterschätzter Meister" seines Fachs, dessen Werk jenseits der bekannten Aids-Serie kaum Beachtung findet.