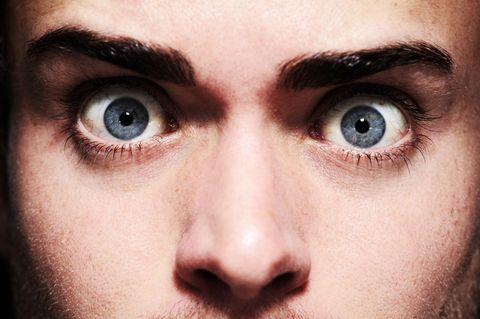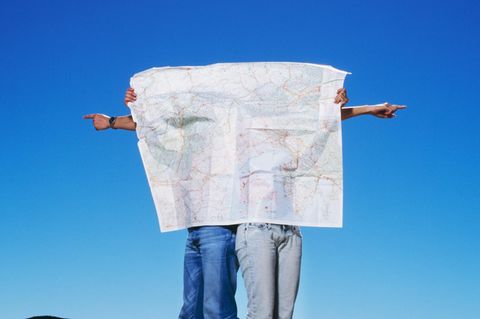Die Welt ist dem Untergang geweiht. So zumindest das Gefühl, das sich breitmacht. Klima, Pandemie, Krieg, Inflation – die Krisen der Welt sorgen nicht gerade für Zukunftsoptimismus. Am härtesten trifft das die Millenials und die Gen Z. Anders als andere Generationen vor ihnen verlieren sie zunehmend den Glaube daran, sich etwas aufbauen zu können. Statt das sauber verdiente Geld für später zu sparen, hauen sie ihre Kröten direkt auf den Kopf – und das augesprochen exzessiv. Mit dem sogenannten Doomspending, das in etwa so viel bedeutet wie "unheilvolles Shoppen", versuchen sie sich von dem Schmerz, den der Tsunami an Negativmeldungen auslöst, zu kurieren. Ängste und Sorgen sollen durch Impulskäufe gelindert werden. Es ist ein teures Tauschgeschäft für ein bisschen Glücksgefühl.
Shoppen als Selbsttherapie ist kein neues Phänomen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ein kleiner Kaufrausch tatsächlich positiv auf die Stimmung wirken kann. Denn das Gehirn schüttet dabei Dopamin aus, ein Botenstoff, der auch als Glückshormon bekannt ist und Glücksgefühle auslöst. Bekannt ist das unter anderem vom Frustshoppen, also dem schnellen, billigen Kick, der einen schlechten Tag etwas besser machen kann. Doomspending hingegen ist laut "Bloomberg" sowas wie die Hardcore-Version der sogenannten Mädchenmathematik, die da lautet: Ist die Hose um 20 Euro reduziert, habe ich 20 Euro gespart.
Unvernünftiges Shoppen gegen den Weltschmerz
"Wir beobachten, dass die Menschen gedankenlos einkaufen, um ihre Sorgen über die Wirtschaft und die Außenpolitik, welche ihr finanzielles Wohlergehen beeinträchtigen könnten, zu beruhigen“, beschreibt es Courtney Alev, Beraterin bei Credit Karma, in einem Bericht zu einer Umfrage, welche das Finanzunternehmen Ende des vergangenen Jahres in den USA durchführte. Das mobile Shopping befördere das Doomspending ähnlich verhängnisvoll, wie die Nachrichtenflut auf dem Smartphone das Doomscrolling. Doomscrolling bezeichnet den Umstand, dass man (zu) viel Zeit am Bildschirm damit verbringt, negative Nachrichten zu lesen.
Zukunftsängste treiben laut Bericht vor allem jüngere Generationen zunehmend in den kostspieligen Konsum, sie geben mehr Geld aus als gewöhnlich. So rechtfertigte eine 24-Jährige gegenüber "Bloomberg News" ihre gelegentlichen "kleinen Luxus-Käufe“ mit der globalen Erwärmung, politischen und sozialen Unruhen auf der Welt und der schlechten wirtschaftlichen Lage. Der "kleine" Luxus: eine Chanel-Tasche für umgerechnet rund 2300 Euro. Wenn einen das Sparen allein nicht ansatzweise den Summen näherbringe, die beispielsweise für den Hauskauf nötig wären, erklärt sie, sei es schlicht "einfacher, Geld für Dinge auszugeben, die einem sofortige Befriedigung verschaffen". Der Gedanke, dass sich das Sparen auf lange Sicht nicht rechnet, der Verzicht sich also nicht lohnt, wirkt demnach als Treiber für unvernünftige Ausgaben.
Konsum als kurzzeitiger Glückstreiber
Die Psychologin Dion Terrelonge, bekannt auch als "The Fashion Psychologist", bezeichnet die Tendenz junger Menschen, in Luxusartikel zu investieren, gegenüber der "Vogue" als eine Möglichkeit, zumindest das Gefühl der Kontrolle zurückzuerlangen. "Doomspends [sind] ein Ausdruck dessen, was wir den Wechsel von passiv zu aktiv nennen. Wobei das Passive die vielen Dinge sind, die wir vielleicht in der Welt ändern wollen, aber nicht können, und das Aktive der Kauf von Dingen", so Terrelonge.
Das Problem: Keine noch so schöne Handtasche kann die Krisen der Welt lösen. Konsum hat nur einen kurzzeitigen positiven Effekt. Zudem kommt Dopamin immer mit einer Kehrseite: die Ausschüttung des Glückshormons kann süchtig machen. In einer Gesellschaft, in der Konsum großgeschrieben wird, keine geringe Gefahr.
Quellen: Bloomberg, Business Insider, Psychology Today, Vogue