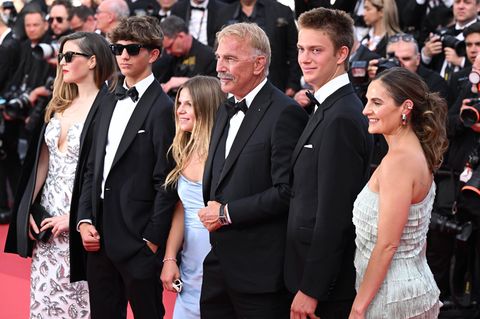Herr Grave wird diesen sommerwarmen Tag einen ganz gewöhnlichen Tag nennen. Er wird sagen, der Tag sei weitgehend normal verlaufen, ohne besondere Vorkommnisse. Herr Grave hat lediglich einer Kellnerin an die Brust getickt und seine Zunge zwischen die Scherblätter des elektrischen Rasierapparats gesteckt. Er hat im Cafe seinen Finger in den Apfelkuchen mit Sahne gebohrt und die linke Hand einige hundert Mal gegen seine Stirn geklatscht. Und abends im Kino, als die Filmmusik verstummte und Kevin Costner Tränen über die Wangen liefen, hat Herr Grave in die Stille des voll besetzten Saals hinein »Fick« gerufen, deutlich hörbar: »Fickfotzfahei.«
Dieser ganz normale Tag im Leben des Berthold Grave hätte auch anders verlaufen können. Herr Grave aber hat dem Bäcker diesmal nicht den Stinkefinger gezeigt und das Weinglas nicht zerbissen, wie er es manchmal tut. Er hat die glühende Zigarette nicht in seine Haut gebrannt und ist gar nicht erst in Versuchung geraten, dem Kanzler während eines Sektempfangs in den Schritt zu ticken. Nicht zugreifen, das möchte Herr Grave betonen, nur ganz kurz anticken. Das wär's.
Berthold Grave ist 45, ein großer, kräftiger Mann mit kahler Stirn und blauen Augen und einem schon grauen Haarkranz. Er hat eine warmherzige Stimme und ein freundliches Lächeln, und an guten Tagen sehe er so aus wie der Schauspieler Armin Müller-Stahl, finden seine Freunde. Es gibt nicht wenige Menschen, die Herrn Grave für hochgradig verrückt halten, für ein besonderes Exemplar im Kuriositätenkabinett psychischer Deformitäten. Es gibt Neurologen, die ihn in die Psychiatrie einwiesen, und Psychiater, die ihn mit Neuroleptika abfüllten, bis Herr Grave glaubte, eine wandelnde Giftmülldeponie zu sein. Ein Rezept gegen die Aussetzer in seinem Kopf jedoch fanden die Mediziner nicht.
Mehr als 25 Jahre lang befand sich Berthold Grave aus Neunkirchen-Vörden in einem Hohlraum ärztlicher Diagnostik. Er war sich selbst ein Mysterium, ein Anschauungsobjekt für Ärzte, eine Freak-Show für Passanten, ein Poltergeist im dichtmaschigen Netzwerk der Regeln und Normen. Er war ein Mensch ohne Grenzen, mit einer Störung ohne Namen. Mehr als 25 Jahre lang suchte Herr Grave nach dem Grund für sein abnormes Handeln, nach diesem kleinen, kaum domestizierbaren Teufel im Kopf, der ihn all die Dinge tun lässt, die man in einer zivilisierten Gesellschaft nicht tut. Eine Erklärung fand er nicht in diesen 25 Jahren, nur eines war Berthold Grave von Anfang an klar: Verrückt bin ich nicht. Er hatte Recht.
Die Geschichte des Herrn Grave ist die eines großen Irrtums. Sie ist tragisch und komisch zugleich, ein bitter-wahres Märchen, wie Herr Grave selbst sagt, das ihn immer wieder vor dieselben Fragen stellt: Was ist eigentlich normal? Was ist verrückt? Und wie viel Abnormität kann eine Gesellschaft ertragen? Eigentlich, so findet nämlich Herr Grave, ist er ein ganz normaler Mensch, mit einem normalen Beruf und einer normalen Familie und einem Haus auf dem Land und einem Garten mit Rasenkantenplatten und einem Lamellensichtschutz aus Kiefernholz, 298 Euro im Baumarkt, ganz normal. Und wenn er beim Bäcker wieder mal seine Stirn gegen die Ladentheke reibt oder in der Kirche den Mittelfingergen Altar reckt, fällt das keinem im Ort mehr auf, keiner lacht, keiner spottet, alles ganz normal. Erst wenn Herr Grave sein kleines Dorf im Südoldenburger Land verlässt und hineingerät in eine andere, in die allgemein geltende Normalität, beginnt ein Spießrutenlaufen, das zu ertragen jeden normalen Menschen verrückt machen müsste.
An diesem sommerwarmen Tag verlässt Herr Grave sein Dorf schon früh und fährt nach Osnabrück, in die nächste größere Stadt, etwa 30 Kilometer entfernt. Manchmal zuckt seine Hand am Steuer, und für den Bruchteil einer Sekunde macht der Wagen einen Schlenker, aber es passiert nichts, es sei nie etwas passiert, sagt Herr Grave, ganz bestimmt, alles normal. In der Fußgängerzone kauft Herr Grave ein Geschenk für seine Nichte und betritt anschließend ein Cafe. In der Brust registriere er ein leichtes Flimmern, sagt er. Er setzt sich an einen Tisch. Er mustert die Gäste. Das Flimmern in der Brust wird stärker. Sein linker Arm beginnt zu zucken. »Wenn ich unter fremden Menschen bin, steigt der Druck«, sagt Herr Grave. »Dann will das Minimonster in meinem Körper vor sich hintoben wie so ein Elefant im Porzellanladen.« Herr Grave wird solche Sätze in diesen Tagen häufiger sagen, ohne zu stottern, zu zucken oder zu schreien, alles ganz normal. Doch plötzlich, ohne jede Vorwarnung, schleudert sein Kopf nach hinten, als habe ihn jemand gewaltsam niedergestreckt. Er sperrt den Mund weit auf, einem tonlosen Schrei gleich, die Zunge schießt hervor, und eine Urgewalt beginnt durch seinen Körper zu irren, schleudert ihn vor und presst ihn zurück, lässt ihn wippen und treten und Wortfetzen ausstoßen, kantig und laut: »Das ist jetzt fickfotz wieder ein komplexer Tic hei, ich hei fickfotz.«
Die Menschen im Cafe drehen sich um. Herr Grave versucht, sich zu zügeln, aber der Körper folgt seinen Befehlen nicht. Er knallt das Salzfass auf den Tisch, immer rauf auf diesen Tisch dieses Salzfass auf den Tisch, er bohrt den Finger in den Kuchen, immer rein in diesen Kuchen diesen Finger, in den Kuchen, immer rein. Die Menschen im Cafe fangen an zu grinsen. Herr Grave spürt einen immer stärker werdenden inneren Druck, kurze Impulse, die sich ruckartig entladen und die er nicht unterdrücken kann wie einen Schluckauf oder ein Niesen. Er schlägt den Löffel in die Kaffeetasse. Der Kaffee spritzt. Er knallt mit dem Knie gegen den Tisch. Der Tisch wackelt. Die Menschen im Cafe prusten vor Lachen.
Herr Grave steht auf, schweißgebadet und erschöpft, verlässt das Cafe, verlässt die Stadt, die Menschen und kehrt zurück in die Geborgenheit seines Dorfes, seines Hauses, seines Zimmers, wo das Minimonster in ihm toben kann, so viel es will, jenes Monster, dessen Namen er heute kennt, doch das zu bändigen er nie in der Lage sein wird.
Die Geschichte des Berthold Grave und seiner hochkomplexen Krankheit beginnt vor über 30 Jahren, an einem Sonntag, er erinnert sich genau. Es sitzt im Kino, als er zum ersten Mal, damals elfjährig, ein Zucken seiner Augenlider wahrnimmt. Auch die Finger beginnen bald zu zucken, die Arme zu schleudern, die Mundwinkel zu zittern, und irgendwann schüttelt Berthold auch seinen Kopf, schüttelt ihn wieder und wieder, wie ein hospitalisiertes Tier. Die Eltern halten das für Faxen eines unerzogenen Jungen und ermahnen ihn, diese zu unterlassen, aber je häufiger sie das tun, desto stärker entziehen sich seine Bewegungen der Kontrolle.
Jeden Morgen wacht der blonde, noch schmächtige Berthold nun auf mit der Angst vor dem, was der Tag an neuen Katastrophen bereithält. Die Muskelzuckungen paaren sich mit Zwangshandlungen, der Junge spuckt plötzlich und unvermittelt auf den Boden, wedelt mit den Händen wie ein Dirigent beim Crescendo und beginnt alles in seiner Umgebung anzuticken: Menschen, Gläser, frisch geputzte Fenster, besonders gern nach dem Verzehr eines Hähnchens, wenn die Finger schmutzig und fettig sind und die Empörung seiner Mitmenschen am größten ist. Der Nervenarzt diagnostiziert eine Mandelentzündung und verschreibt Kalktabletten. Der Psychologe tippt auf ein hyperkinetisches Syndrom und spricht von einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung. Es sind abenteuerliche Diagnosen, die die Mediziner stellen, um ihre Ahnungslosigkeit hinter Namen zu verstecken.
In seiner Jugend bekommt Berthold Grave zu spüren, wie gnadenlos das Leben sein kann. Zwar ist er beliebt bei seinen Freunden, ein humorvoller, intelligenter Schüler, und wenn er im Unterricht einschläft, weil die Valiumdosis das Tempo aus seinem Körper saugt, mokiert sich keiner mehr über ihn. Doch draußen im wahren Leben, in den Discos und auf Volksfesten, wird er zur Attraktion, zu einer One-Man-Show mit Heiterkeitsgarantie. »Bell noch mal, Hund«, rufen ihm die Jugendlichen zu und imitieren seine wilden Zuckungen. »Besser als ein Spasti«, rufen sie. Einmal verprügelt Berthold einen dieser Typen, aber dann, geplagt von Selbstzweifeln, fragt er sich: Soll ich nun all den Tausenden Menschen aufs Maul hauen, die sich über mich lustig machen? So zieht er sich lieber in sein Zimmer zurück. Weint in sein Kissen und fragt sich, was das für eine Macht ist, die tief in ihm dieses herrische Eigenleben führt.
Berthold Grave versucht, in seine Kindheit einzutauchen, versucht, die Windungen seines bisherigen Lebens zu durchkämmen, aber es findet sich kein Trauma und keine Psychose. Seine Kindheit ist so ruhig und unspektakulär wie die Gegend, aus der er kommt, Werlte im Emsland. Nach dem Abitur zieht er fort, nach Vechta und Bremen, wo er Sozialpädagogik studiert und sich im Schoß der alternativen Subkultur mehr Verständnis erhofft. Doch seine Ausfälle verstärken sich noch. Sie nehmen autoaggressive Züge an. Er hackt sich mit den Fingernägeln in die Stirn, wie ein Automat so mechanisch. Und drückt Zigarettenstummel in die Haut, kurz und präzise, fast 1000 Grad heiß, um diese feine Linie zwischen Wahrnehmung und Schmerz zu treffen. Auch Schleifsteine fasst er an und rotierende Bohrer und bricht nun jede Regel und jedes Verbot wie ein widerborstiges Kind, schreit in der Oper, flucht im Kino, spuckt im Gotteshaus. Im Rijksmuseum in Amsterdam steht Herr Grave vor einem Rembrandt-Gemälde mit dem Hinweis »Don't touch«. Für ihn ist es die Aufforderung, das Gemälde so zu berühren, dass die Alarmanlage nicht schellt. Sie schellt.
Da kein Arzt ihn zu heilen weiß, probiert Berthold Grave es mit Gesprächstherapien und neurohomöopathischer Behandlung. Seine Seele wird nun zur Großbaustelle, sein Körper zum Experimentierlabor. Ohne Ergebnis. Er geht in die Psychiatrie und bekommt Medikamente verschrieben, Psychopharmaka und Gehirnblocker, die ihn vom Leben abschneiden und ihn einhüllen in meterdicke Watte. Doch wenn er die Kliniken verlässt, sind die Detonationen in seinem Kopf stärker als je zuvor.
Berthold Grave lebt die meiste Zeit allein, und als er eine Partnerin findet, die große Liebe, merkt er, dass ein Mensch wie er für Nähe nicht geschaffen ist. Er beißt und kratzt die Frau, die er liebt, und testet täglich die Grenzen ihrer Toleranz. Als sie ihn bittet, in der Fußgängerzone einen halben Meter hinter ihr zu gehen, weil sie das Gespött der Passanten nicht mehr erträgt, ist die große Liebe am Ende.
Mit 26 ist Berthold Grave im Souterrain der Gesellschaft angekommen. Die Zuckungen am ganzen Körper sind so stark, dass er nicht mal mehr ein Brot schmieren oder ein Glas halten kann. Er schließt sich ein, ernährt sich von Astronautenkost aus der Apotheke, saugt sie durch einen Strohhalm und beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er legt sich die Tablettenberge schon zurecht - und schleppt sich doch weiter von Tag zu Tag.
In all diesen Jahren hat Berthold Grave das Gefühl: Eigentlich bin ich ein normaler Mensch mit einem klarem Verstand, und mit den Anfällen kann ich irgendwie leben. Jedoch die Gesellschaft kann es nicht. Für die Gesellschaft ist Berthold Grave ein Mensch, der die jahrhundertealten Regeln des Anstands und Miteinanders sprengt, der sich wie ferngesteuert dorthin begibt, wo Tabus noch zu brechen sind, und der für seine Störung nicht mal eine Entschuldigung hat, ein Attest, wenigstens einen Begriff. Das ist das Schlimmste in einem Land obsessiver Kennzeichnungspflicht. Wäre er ein Epileptiker, so hätte er einen Namen für sein Problem. Wäre er ein Spastiker, so träfe er auf Milde. Wäre er geisteskrank, so nähme er die Erniedrigungen nicht wahr. Aber er ist nichts davon. Er ist ein weißer Fleck in der Wissensgesellschaft. Fremde Menschen bekreuzigen sich, wenn sie den zuckenden, schreienden Mann auf der Straße sehen, und tatsächlich gibt es Momente, da auch er, Berthold Theodor Grave, diplomierter Sozialpädagoge und katholischer Christ, sich fragt, ob ein Dämon sich in seinem Körper eingenistet hat.
Nach mehr als 25 Jahren der Suche, an einem warmen Junitag, entdeckt Berthold Grave in einem Fachmagazin einen Artikel über Menschen, die aus unerfindlichen Gründen zucken und zappeln, grunzen und fiepen und ihre Mitmenschen täglich vor ein unlösbares Rätsel stellen. Das bin ich, denkt sich Grave. Das ist das Minimonster in mir. Für sein Handeln gibt es auf einmal einen Grund, für seine Krankheit einen Terminus: TS, Tourette-Syndrom, benannt nach dem französischen Arzt George Gilles de la Tourette. Eine kaum erforschte neuropsychiatrische Erkrankung, die durch so genannte Tics charakterisiert ist, unwillkürliche, mitunter sehr heftige Bewegungen, die immer wieder in ähnlicher Weise auftreten.
Für Berthold Grave ist die Diagnose eine Erlösung. Endlich hat er die Bestätigung: Er ist nicht verrückt. Und nicht besessen. Er ist auch nicht allein. Es gibt andere. 40.000 sollen es in Deutschland sein. Viele, so erfährt er nun, haben nur schwache Tics, ein Zucken der Lider, ein Zappeln des Armes, sie leiden aber nicht unter dem Zwang, all es anticken zu müssen (»Touching«), plötzlich zu schreien (»Klazomanie«) oder die Gesten anderer Menschen nachzuahmen (»Echopraxie«). Doch Herr Grave hört auch von TS-kranken Kindern, die in Psychiatrien abgeschoben werden; von Jugendlichen, die sich, blind vor Selbsthass, umbringen wollen; von Erwachsenen, die sich einschließen, isolieren, weil kaum eine andere Krankheit einen so zum Gespött der Menschheit macht. Am schlimmsten trifft es jene, die wildfremden Menschen ständig den Stinkefinger zeigen (»Kopropraxie«) und zwanghaft obszöne Wörter ausstoßen (»Koprolalie«). Die in den Bus einsteigen und bei klarem Verstand plötzlich rufen: »Heil Hitlers Töchter haben auch guten SexSexSex.«
Herr Grave fährt zu Spezialisten nach Hannover und Göttingen, im Kopf Hunderte von Fragen, aber definitive Antworten erhält er nur wenige. Vererbbar? Wahrscheinlich. Heilbar? Bisher nicht. Ursachen? Weitgehend unerforscht. Die Neurologen vermuten, dass beim Tourette-Syndrom der Stoffwechsel von mindestens einer chemischen Substanz, einem so genannten Neurotransmitter, gestört ist, sodass die Kontrolle von Bewegungen und Sprache durch das Gehirn nicht immer funktioniert. Körperlich und geistig sind TS-Kranke so normal wie jeder andere.
Mit dem Wissen um sein Schicksal kann Berthold Grave sein Leben in andere Bahnen lenken. Er arbeitet in Neuenkirchen als Sozialpädagoge mit geistig behinderten Kindern, er verliebt sich in eine 15 Jahre jüngere Frau und heiratet sie. Zusammen bekommen sie eine Tochter, Lea. Sie wird zum Fixpunkt seines Daseins, der lebende Beweis für seine Rückkehr in die Randzonen der Bürgerlichkeit, und für Lea gibt es nichts Normaleres als Papas, die ab und zu mal schreien, bellen und einen ständig anfassen.
Manchmal fürchtet sich Herr Grave davor, Leas Fontanelle einzudrücken, diese runde, weiche Stelle am Kopf. Da muss man doch mal draufdrücken auf diese Fontanelle, da muss man doch mal reinschauen in dieses Köpfchen, tief hinein. Er tut es nicht. Vor den schlimmen, lebensbedrohlichen Aktionen macht die Krankheit Halt, als wäre dem Gehirn ein Notrelais vorgeschaltet.
Am frühen Abend dieses ganz normalen sommerwarmen Tages geht Herr Grave ins Dorf. Er plaudert mit Nachbarn, schmeichelt jungen Frauen, summt Lieder vor sich hin, Pink Floyd, Nina Hagen, und sagt, er sei glücklich. Beim Metzger hält er einen Sicherheitsabstand zur Theke, um nicht auf das wunderschön blanke Putensteak zu spucken. Beim Griechen im Restaurant erhält er dicke Weingläser, um nicht erst in Versuchung zu geraten, sie zu zerbeißen. Herr Grave hat sich ein Vorsorgenetz geschaffen, ein Krisenabwehrsystem, das die Menschen und ihn vor dem Schlimmsten bewahrt.
Erst später am Abend, im Kino des Nachbarortes, als er in den Hals seiner Bierflasche beißt und sich ein Glassplitter im Zahnfleisch verfängt, als er Kevin Costner imitiert, die Gesten und die Mimik, und dessen Sätze unfreiwillig nachspricht, als schließlich das Kichern der Besucher kein Ende nimmt, wird Herrn Grave wieder bewusst, wie erniedrigend diese Krankheit ist, »eine einzige verdammte Selbstvergewaltigung, eine einzige beschissene Psychofolter«. Er steht auf, geht auf einige Jugendliche zu und sagt, mit ernstem Gesicht: »Ihr dürft gern lachen. Ich verstehe das. Aber ich habe eine seltene Krankheit, über die ich keine Kontrolle habe.« In diesem Moment fragt sich keiner im Saal mehr, ob dieser große, kräftige Mann mit den blauen Augen und der kahlen Stirn verrückt ist.
So geht er zu Ende, dieser Tag im Leben des Berthold Grave. 6000 motorische und vokale Tics liegen hinter ihm, durchschnittlich etwa fünf Tics pro Minute. Er kehrt zurück in sein frisch erbautes, rot geklinkertes Haus. Er sagt, nun völlig ruhig: »Wenn wir es schaffen, Tourette bekannt zu machen, würde man irgendwann so selbstverständlich darüber reden wie über Multiple Sklerose. Ich könnte in jede Stadt gehen, und die Menschen würden sagen: Aha, Tourette. Nicht schön, aber so schlimm ist es nun auch nicht.«
Dann fallen ihm die Augen zu, und ein letzter Schrei entgleitet seinem aufgerissenen Mund. Oben im Kinderzimmer wird seine Tochter Lea nun in Ruhe schlafen können. Der Schrei ist wie ein Gutenachtlied für sie, das ganz normale abendliche Signal: Papa ist bei mir.
Jan Christoph Wiechmann