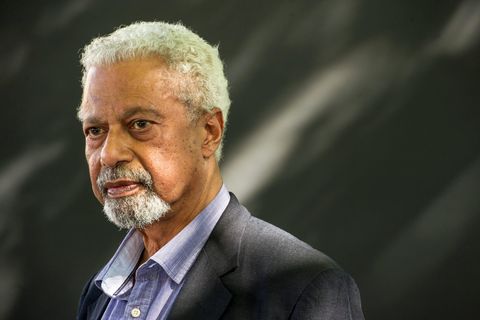| Pro | Kontra | |
|---|---|---|
| Von Gerda-Marie Schönfeld Immer mal wieder kommt einer vorbei - diesmal im stern und auf welt.de - der bündig die Abschaffung des Literaturnobelpreises fordert, aus mehr oder weniger schlechten Gründen. Um Himmels Willen, bloß nicht. Meist sind das Leute, deren Lieblinge gerade nicht geadelt wurden. Dabei ist es doch ein grosses Glück, dass in Stockholm seit mehr als hundert Jahren ein paar griesgrämige alte Männer sitzen und als Hüter des Wahren, Schönen, Guten einmal im Jahr auf die Leistungsträger dieser Welt blicken, tief nachdenken, dann den Kopf heben und verkünden: Der isses. | Von Stephan Maus Anfang Oktober pöbelte der Vorsitzende der schwedischen Literaturnobelpreisjury, Horace Engdahl, amerikanische Schriftsteller seien zu isoliert und zu unwissend, um große Literatur schreiben zu können. "Sie übersetzen nicht genug, und sie nehmen nicht wirklich am großen Dialog der Literatur teil." Eine Woche später verkündete Engdahl den diesjährigen Literaturnobelpreisträger. Jean-Marie Gustave Le Clézio ist ein Mann, der laut eigener Auskunft weder Radio hört noch Zeitung liest. Man könnte also sagen, Le Clézio sei ein ziemlich isolierter Autor. |
| Diesmal also Jean-Marie Gustave Le Clézio. Ein Franzose. Ein sehr gelehrter Franzose. Der 1940 in Nizza geborene nagelneue Literaturnobelpreisträger ist Literaturwissenschaftler und Philosoph. Also was für Fortgeschritte. Deshalb kennt man ihn hier kaum. Er gilt als ein Poet des einfachen Lebens, der gern die Entfremdung des urbanen Menschen in den grossen Städten des westlichen Kapitalismus' beklagt. Also ein Langweiler. Da solche Zivilisationskritik in Zeiten des entfesselten globalen Raubtier-Kapitalismus' als Ausweis von Kultur gilt, war die Wahl gar nicht so verwunderlich. Denn das schwedische Nobelpreiskomitee gibt am liebsten den Leuten viel Geld, die in ihren Büchern schreiben, dass sie Leute mit viel Geld nicht leiden können. Inzwischen sind das 1,1 Millionen Euro. Schöne Botschaft Der Literaturnobelpreis ist, ebenso wie der Friedensnobelpreis, die Software der Institution. Während die Hardware Chemie, Physik, Medizin etc. politisch nicht verhandelbar ist, kann das Komitee in Sachen Literatur durchaus auch Politik machen. Die südafrikanischen Schriftsteller Nadine Gordimer (1991) und J. M Coetzee (2003) wurden auch für ihr frühes Engagement gegen die Apartheid ausgezeichnet, ebenso wie die Russen Boris Pasternak (1958) und Alexander Solschenizyn (1970) als Regimegegner honoriert wurden. Desgleichen der Chinese Gao Xingjian (2000), der in seiner Heimat eine unerwünschte Person ist und inzwischen im französischen Exil lebt. Die schöne Botschaft heißt hier: Wir vergessen euch nicht. Dazu kommt, dass die Herren aus Stockholm die Herren Diktatoren ganz schön in Wut und damit ins Rampenlicht der Welt bringen können. Pasternak beispielsweise durfte den Preis im Jahre 1958 weder annehmen noch aus der Sowjetunion ausreisen. Über beides wurde ausführlich berichtet. Und dann der charmante protestantische Masochismus der "Chefgerontologen aus Stockholm" (welt.de). Nehmen wir nur Elfriede Jelinek. Die Frau tut seit Jahrzehnten nichts anderes, als in ihren Büchern Horden von griesgrämigen alten Männern abzuwatschen. Und was geschieht? Ein Horde griesgrämiger alter Männer beugt sich über ihr Werk und spricht: Die isses. So wurde die Österreicherin im Jahre 2004 mit dem Nobelpreis und 1,1 Millionen Euro geehrt. Hedge-Fonds Selbst die unermüdlichsten Kritiker des globalen Raubtierkapitalismus, wie Günter Grass, werden aufs feinste belohnt. Seit die Stiftung in Immobilien, Aktien und Hedge-Fonds (!!!) investieren darf, ist das Preisgeld von 150.000 Euro (1970) auf heute 1.1 Millionen Euro gestiegen. Auf Grass entfielen im Preisjahr 1999 ca. 920.000 Euro. Aber wir reden doch von Kunst und nicht von Geld, werden Sie hier einwenden. Wirklich? Zwar hat Sartre mit seinem bombenfesten Satz: "Der Schriftsteller muss sich weigern, sich in eine Institution verwandeln zu lassen" seine Ablehnung des Literaturnobelpreises 1964 begründet. Was ihn allerdings nicht daran gehindert hat, ein paar Jahre später heimlich beim Kassenwart in Stockholm das Preisgeld abzufordern, ca. 125.000 Euro. War aber schon wech, das Geld. "Kultur, die auf sich hält, ist unzähmbar und beißt die Hand, die sie füttern will", schreibt mein Kollege Stefan Maus. Ganz falsch. Keine Branche wird so gefüttert wie die Kultur. Oder hat schon jemals ein Klempner ein so allerliebstes Stipendium bekommen wie ein kostenloses Jahr in der Villa Massimo in Rom? Zur Geschäftsgrundlage dieser Branche gehört , dass sie kräftig in die Hände beißt, die sie füttert. Das ist völlig in Ordnung und wird durchaus von der schwedischen Akademie honoriert. Auch das ist schön. "Ausgeben! Ausgeben! Ausgeben!" Noch schöner ist, wenn sich einer einfach mal freuen kann. Übers Geld. Wie Imre Kertész. Der Ungar, Auschwitz-Überlebender und im kommunistischen Ungarn nicht gut gelitten, verbrachte Jahrzehnte in einer kargen Dachkammer in Budapest. Als ihm im Jahre 2002 der Preis überreicht wurde, dazu ein Scheck mit 1,1 Millionen Euro, sagte Kertész auf die Frage, was er denn nun mit dem Geld mache, mit leuchtenden Augen: "Ausgeben! Ausgeben! Ausgeben!". Günter Grass hat sein Preisgeld seiner Stiftung vermacht. Das ist brav. Aber lange nicht so sexy wie die leuchtenden Augen von Imre Kertész. |
Dickes Fell
Le Clézio ist seit mehr als 40 Jahren einer der zuverlässigsten Kitschgeneratoren in Old Europe. Das Durchschnittsalter der schwedischen Akademiker von über 70 Jahren könnte ihre Anfälligkeit für Le Clézios Kleinmädchensehnsüchte und seinen Poesiealbumschwulst voller bukolischer Abziehbilder erklären. Trotzdem erstaunlich, dass diese Kosmopoliten Poesie nicht von Reisekatalog-Prosa unterscheiden können.
Natürlich könnte man nun wieder seitenlang über die Unfähigkeit der Schwedischen Akademie schwadronieren. Und natürlich könnte man jetzt auch wieder all die übergangenen Genies zitieren, von Kafka und Joyce bis hin zu Nabokov. Aber all das ist nebensächlich.
Es ist etwas faul im Königreich Schweden, und es stinkt. Das ist der Literaturnobelpreis an sich. Man sollte ihn abschaffen. Denn er gründet auf einer falschen Idee: Wer diesen Literaturkarneval akzeptiert, nimmt an, dass es über dem größten Schriftsteller noch ein Gremium geben könnte, das würdig und sachkundig genug wäre, diesen Autor auszuzeichnen. Ein Gremium, das es wert wäre, sich während seiner Zeremonien mit Kronleuchtern, Seidenstühlen und bräsiger Selbstzufriedenheit hemmungslos selbst zu feiern. Ein Gremium mit einem Vorsitzenden, der die Autorität besitzt, einmal im Jahr elchgleich etwas über die Weltmeere zu röhren. Preisträger, Unflätigkeiten, irgendetwas. Hauptsache, röhren. Doch diese Annahme ist ein Irrtum. Über großer Literatur gibt es nichts mehr. Gar nichts. Schon gar keine Akademie. Kunst ist etwas Unfassbares. Flirrendes. Ungefähr so etwas wie ein Nordlicht, liebe Schweden. Nordlichtern hängt man auch keine Orden um. Sobald eine Institution sich der Kunst bemächtigt, geschieht dies nicht aus Respekt, sondern um die Macht der Institution durch die Strahlkraft der Kunst zu festigen. Sei das die Macht einer Akademie, einer Bank oder eines Staates.
Das "Ich" als Mittelpunkt
Wenn es überhaupt eine Daseinsberechtigung für Literatur gibt, dann besteht sie in der einmaligen Chance, dem Leser für einige Stunden einen Geschmack absoluter Freiheit zu vermitteln. Diese Idee der kompromisslosen Freiheit ist unvereinbar mit der geborgten Autorität, die ein Preis aus institutionellen Händen verleiht. Hier wirkt nicht mehr die Kunst, sondern pappt das Etikett.
Preise und Ehrungen dienen einzig der institutionellen Selbstbeweihräucherung. Das Abscheuliche solch narzisstischer Zeremonien hat niemand besser verstanden als Jean-Paul Sartre, der 1964 den Literaturnobelpreis mit folgenden Worten ablehnte: "Der Schriftsteller muss sich weigern, sich in eine Institution verwandeln zu lassen." Kultur, die auf sich hält, ist unzähmbar und beißt die Hand, die sie füttern will.
Man sollte den schwedischen Kulturzirkus mit seinen Dressurnummern auch deshalb abschaffen, weil in der Manege immer ein Stück Literatur stirbt. Bis heute sind wenige Autoren bekannt, die nach Verleihung des Nobelpreises noch ein gutes Buch geschrieben hätten. Aus Stockholm kommt der sichere Todeskuss für viele Schriftsteller. So gesehen ist die diesjährige Wahl vielleicht nicht die schlechteste. Denn wir wollen noch viele Bücher von Thomas Pynchon, Denis Johnson und all diesen anderen kulturfernen Amerikanern lesen. endtokentd endtokentr endtokentable