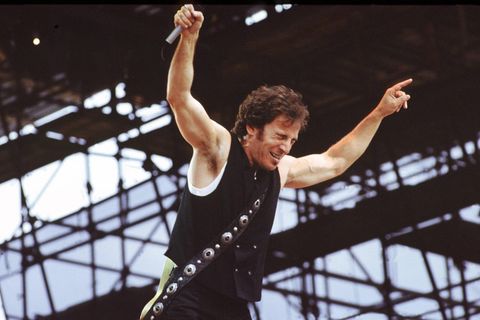Vor 75 Jahren sorgte Walter Ruttmann mit seinem Stummfilm »Berlin: die Sinfonie der Großstadt« für Aufsehen. Ein Tag in der schnelllebigen Stadt wird mittels in einem rasanten Tempo aneinandergereihten Einstellungen und Schnitten dargestellt. Dokumentarfilmer Thomas Schadt war so begeistert von dem lebendigen Film, dass er vor zwei Jahren mit den Dreharbeiten zu einer Neufassung begann. Sie trägt den fast identischen Titel »Berlin: Sinfonie einer Großstadt«.
Berlin in Schwarzweiß und ohne Ton
Auch die neue Großstadt-Sinfonie schildert einen Tag in Berlin. Und Schadt drehte wie Ruttmann mit 35mm-Schwarzweiß-Material und ohne Ton. Bei beiden soll nicht Berlin an sich, sondern eine Stadt im Mittelpunkt stehen. Es gibt jedoch auch zahlreiche Unterschiede.
Liebeserklärung an die Stadt
Anders als Ruttmann lässt Schadt eine Einstellung auch mal eine Minute lang stehen, zeigt nicht nur Menschenmassen, sondern porträtiert auch einzelne Menschen. Anders als Ruttmann, dessen Film kühle Distanz ausstrahlt und der auch mal einen Selbstmord zeigt, ist Schadts Produktion eine Liebeserklärung an die Stadt, in der er seit 22 Jahren lebt. Er wolle überprüfen, was aus Ruttmanns Vision von Stadt geworden ist, erklärt Schadt.
Den Sound liefert das SWR-Sinfonieorchester nach einer Partitur, die Iris ter Schiphorst und Helmut Oehring parallel zu den Dreharbeiten schreiben. Sie wollen »die Härte der schnellen Wechsel« in dieser Stadt in Musik umsetzen.
Keine typischen Berlinbilder
105 Tage nahm Schadt sich Zeit, in Berlin nach passenden Bildern zu suchen. Sein Film beginnt mit einem Feuerwerk in einer Silvesternacht und endet mit Lichtspiegelungen auf einer Wasserfläche. Dazwischen werden Bilder vom Aufwachen der Metropole, von arbeitenden und essenden Menschen, Fabriken, Cafes, Parks, Staus, Politikern, Obdachlosen, Demonstrationen und Hunden gezeigt. Auf typische Berlinbilder wollte Schadt ebenso verzichten wie auf technische Effekte. Sehenswürdigkeiten wie Reichstag, Siegessäule, Kurfürstendamm, Rotes Rathaus oder Gendarmenmarkt sind aber alle zu sehen.
Orientierung fällt bisweilen schwer
Manchmal fällt es schwer, dem rasanten Film zu folgen. Es wird kein Berliner Ereignis ausgelassen: Love Parade, Karneval der Kulturen, Silvesterparty oder das Sechs-Tage-Rennen. Orientierungspunkte gibt es aber doch, wenn die Blicke in regelmäßigen Abständen vom Fernsehturm über das Häusermeer gleiten oder ein Tag im Leben der Bundestagsabgeordneten geschildert wird.
Der Film hat auch witzige Elemente. So sind die hin- und herwandernden Blicke von Zuschauern zu sehen, die den Ball bei einem Tennismatch verfolgen. Plötzlich bleibt die Filzkugel an der Netzkante hängen und springt zurück. Zeitversetzt wenden die Zuschauer, deren Blicke schon weitergeschweift waren, ihre Köpfe um.
Poetisch mit historischem Gewissen
»Mein Film sollte ein historisches Gewissen erhalten«, sagt Schadt. Schließlich sei seit dem 1927 entstandenen Ruttmann-Produktion viel Zeit vergangen. Es folgen Aufnahmen vom jüdischen Friedhof, später Ansichten vom brennenden Reichstag, dem Olympiastadion, dem Areal auf dem einst das Holocaust-Mahnmal stehen soll oder dem Checkpoint Charlie. Die poetische Grundstimmung des Films steht manchmal im Gegensatz dazu.
Spannende Portraits
Am stärksten ist das Leben in der Stadt zu spüren, wenn sich der Film einzelnen Menschen zuwendet. So grüßt ein dunkelhäutiger Portier des Hotels Adlon mit breitem Lächeln einen Gast. Kaum wendet er sich ab, verzieht sich sein Gesicht wieder zur undurchdringlichen Grimasse.
Begleitende Ausstellung
Das Berliner Filmmuseum stellt in einer Sonderausstellung Ruttmanns und Schadts Film gegenüber. In Stuttgart, Frankfurt am Main und München ist der Start für den 18. April geplant.