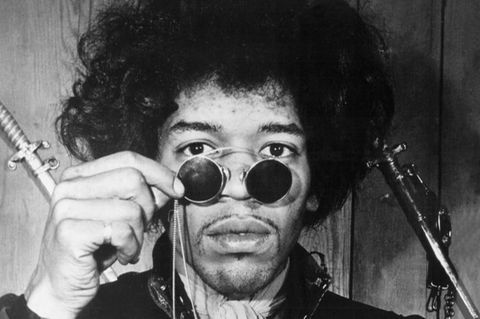Irgendwann ist alles Klang. Ein Geschwelge aus Gitarre und Akkordeon, Stimmen und Streichern, Orgel und Untergang. Das sind die Momente, in denen die Musik von Arcade Fire fast ein wenig unheimlich ist. Aber nur ganz kurz. Dann klingeln ein paar Glöckchen. Und wo die Welt eben noch untergehen wollte, wartet plötzlich die Erlösung. Klingt pathetisch? Geht aber nicht anders: Diese Musik ist Pathos. Erhaben, leidenschaftlich, monumental, großartig. Kitschig? Auch. Aber nur ein bisschen. Arcade Fire machen viel, aber nicht zu viel. Der Boden, von dem ihre bombastischen Stücke zum Höhenflug abheben, ist immer solide: eine gute Melodie.
Im September 2004 veröffentlichte die damals noch völlig unbekannte Band ihr Debütalbum "Funeral" - und sorgte für Begeisterungsstürme. "Funeral" wurde einer jener Erfolge, die ohne Web 2.0, ohne Myspace und die Mundpropaganda des Internets nicht möglich gewesen wären: Mit wenig Promotion bei dem Winz-Label "Merge" erschienen, verkaufte es sich weltweit eine Million Mal. Der englische "New Musical Express", sonst eher geneigt, britische "The-Bands" zu feiern, ernannte die Kanadier vor Kurzem zur "großartigsten Band der Welt". Andere Bewunderer sind: David Bowie, David Byrne (von den Talking Heads), Bono, Beck und Brian Ferry. Unterschiedlicher können Künstler kaum sein. Doch Arcade Fire vereinen sie alle: den großen Pop und die hymnischen Gitarren, die intelligente Dramaturgie und den Ehrgeiz zum Gesamtkunstwerk.
Dabei ist die Band im Grunde total altmodisch. Oder besser gesagt: Sie zelebriert den Anachronismus. Zu altertümlichen Instrumenten wie Mandoline oder Drehleier tragen sie Uropas Klamotten und sehen ein bisschen aus wie Quäker auf Wanderschaft. Auch ihr Bandkonzept ähnelt eher den Zeiten von The Grateful Dead als der modernen Datenkomposition. Arcade Fire haben den Gedanken des musikalischen Kollektivs wieder belebt: zusammen Musik machen, zum Teil sogar zusammenleben, zusammen Ideen entwickeln. Egal, ob Plattencover, Internetauftritt oder Livekonzert - über allem liegt eine geheimnisvolle Versponnenheit. Klickt man auf die aktuelle Website www.neonbible. com, flimmern schwarzweiße Kurzfilme über den Monitor. Und ein kleines Mädchen liest Fabeln vor.
Im Zentrum von Arcade Fire steht das Ehepaar Régine Chassagne und Win Butler. Régine (auf dem Foto in der Mitte) wurde in Haiti geboren und wuchs in Kanada auf. Win (mit Hut) kommt aus Texas, sein jüngerer Bruder Will (links neben ihm) gehört ebenfalls zur Band. Songschreiber Win hat Theologie studiert - und dass die Band einen gewissen Hang zum Sakralen hat, zeigen nicht nur die Albumtitel "Funeral" und "Neon Bible": Für die neue Platte kauften sie eine leer stehende Kirche in der Nähe ihres Wohnorts Montreal und machten sie zu einem Tonstudio.
Der Grund dafür ist allerdings sehr weltlich: Es war die billigste Variante. Schließlich brauchen sie viel Platz. Sieben Leute gehören zu der Band, jeder von ihnen spielt mehrere Instrumente, und Gastmusiker kommen auch noch hinzu. Ihre Lieder erzählen von Fernsehpredigern und dem amerikanischen Alltag, von Bedrohung und dem Kampf dagegen - kleine Opern im Popsong-Format. Durch die Tragödie zur Katharsis, von MTV zum Halleluja, irgendwo zwischen Richard Wagner und dem frühen Bruce Springsteen. Mehr geht eigentlich nicht. Und das hört man am besten laut.