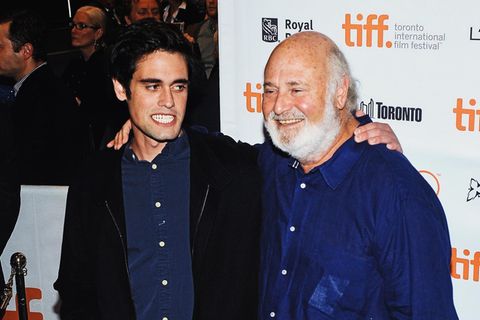Mit fragendem Blick steht Fred Krüppelmann vor 10.000 Fans auf der Spielfläche des Stadions von Alba Berlin und weiß nicht, was er tun soll. Kein neues Gefühl für den von Til Schweiger gespielten Polier, aber nun geht es um eine Grundsatzentscheidung: zickige Chefstochter oder wahre Liebe? Bis zu diesem Punkt ist für ihn bereits eine ganze Menge schief gelaufen.
Doch um wirklich schwungvoll zu sein, ist die Geschichte um einen Bauarbeiter, der um jeden Preis die Liebe von Mara, der Tochter seines Chefs, gewinnen möchte, zu vorhersehbar. Dafür schreckt er nicht einmal vor einem gehörigen Tabubruch zurück. "Entweder besorgst du mir einen handsignierten Basketball von meinem Lieblingsspieler, oder ich sage Mami, du hättest mich angefasst", bringt der verhätschelte Sohn Maras den armen Fred in die Klemme. Um möglichst schnell an den Ball zu gelangen, muss er sich Zutritt zur Behindertentribüne von Alba Berlin verschaffen, denn dort landen die Bälle nach besonders erfolgreichen Partien.
Keine Witze auf Kosten Behinderter
Fred Krüppelmann fasst also zusammen mit seinem Kumpel Alex (Jürgen Vogel) den Plan, seinem Namen alle Ehre zu machen und das nächste Spiel als stummer Rollstuhlfahrer zu besuchen. Was folgt, ist ein peinlicher Klamauk-Marathon, der Fred in die Arme der verzagten Imagefilmerin Denise (Alexander Maria Lara) treibt: Auf der Suche nach Herzschmerz wird sie bei dem scheinbar bemitleidenswerten Fred fündig.
Um allen Befürchtungen vorweg zu greifen: Nein, der Film macht sich nicht auf Kosten Behinderter lustig. Regisseur Anno Saul kommentiert seine Idee etwas hölzern: "Der Humor des Films rekrutiert sich aus der mitunter absurden Unsicherheit, die unsere Gesellschaft Behinderten entgegen bringt." In der Umsetzung schaut das so aus, dass der ungeschickte Kumpel Axel seinen Freund aus Versehen im Rollstuhl eine Wendeltreppe runterschubst und Denise über so viel Nachlässigkeit Bauklötze staunt. Doch spätestens der schuldbewusste Kleine-Jungs-Blick des vermeintlich stummen Freds nimmt ihr die Berührungsängste.
Schablonenhafte Gesichtsausdrücke
Somit bedient sich Saul für seinen Film eines durchaus gängigen Motivs. Die Liebe Maras ist an Bedingungen geknüpft: Wie in manch einem mittelalterlichen Mythos ist dem Helden die Zuneigung lediglich gewiss, wenn er mit Heldentaten auftrumpfen kann, nur dass Fred statt des heiligen Grals einen gewöhnlichen Basketball einbringen soll. Dieses Tauschgeschäft stinkt Fred von Beginn an, aber bis er wagt, auf sein Herz zu hören, muss einiges geschehen.
Die Schauspieler kommen im gesamten Film über ihre wenigen schablonenhaften Gesichtsausdrücke nicht hinaus. Statt mit der politischen Unkorrektheit der Grundkonstellation geistreich zu spielen, rührt Saul altbackene Klischees an und scheitert an seinem Anspruch, an die amerikanischen Screwball-Komödien der 30er Jahre anzuknüpfen. Das Genre zeichnete sich durch besonderen Wortwitz und temporeiche Handlung aus.
"Man liest sofort, dass das Buch aus Amerika kommt: Ein Lacher folgt auf den nächsten. Ich glaube, das funktioniert hierzulande 1:1", kommentierte Til Schweiger einst das Drehbuch. Leider fühlt man sich dabei oft an "Eine schrecklich nette Familie" erinnert und wundert sich, dass die Lacher nicht zur Erinnerung an den Zuschauer noch vom Band rein geschnitten wurden. Oftmals schießt der Film bei seiner "Situationskomik" übers Ziel hinaus und liefert Frauenwitze mit chauvinistischem Anklang, die sich im Jahrzehnt verirrt haben. In Amerika war das Drehbuch abgelehnt worden.