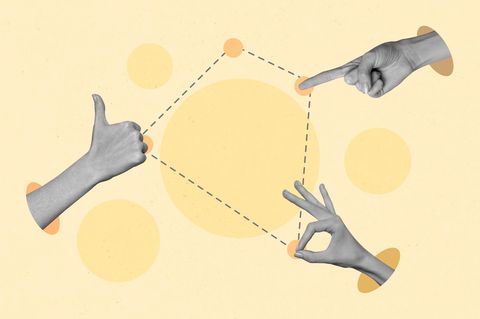Frau Winkler, wie wird man ein guter Hundelehrer?
Die Erfolgsquote muss hoch sein, so lernen Hunde am effektivsten. Ihre Aufgabe ist es also, dem Hund zu ermöglichen, Erfolg zu haben. So steigt auch die Belohnungsrate, und die ist wichtig für die Motivation. Aber es geht zusätzlich darum, den Hund zu verstehen, um Fehlschlüsse zu vermeiden.
Inwiefern hat das Lernverhalten mit Kommunikation zu tun?
Lernen ist wie die Schwerkraft: Man kann es nicht abschalten. Wenn ich begriffen habe, wie es funktioniert, kann ich mir das Verhalten der Hunde viel besser erklären. Andersrum können wir lernen, uns so zu verhalten, dass der Hund uns verstehen kann.
In Ihrem Buch "So lernt mein Hund" schreiben Sie, die operante Konditionierung sei der Königsweg im Training. Worum geht es dabei?
Einfach gesagt: Lernen durch Ausprobieren. Nach dem Motto "Versuch und Irrtum" oder besser "Versuch und Erfolg". Man lernt auch aus Irrtümern, aber noch besser merkt sich das Gehirn erfolgreiche Verhaltensweisen. Bei Erfolg wird das Gehirn gleich zweimal belohnt: Erstens bekommt man das, was man erreichen wollte – bei dem Hund wäre das zum Beispiel ein Leckerchen. Zweitens schüttet das Gehirn Dopamin aus, das für Glücksgefühle und höhere Aufmerksamkeit sorgt.
Zu Beginn eines Trainings: Wie mache ich es meinem Vierbeiner möglichst leicht?
Es geht darum, dem Hund klarzumachen, was Sie von ihm wollen. Also teilen Sie die Übungen in kleine Schritte. Soll der Hund einen Gegenstand im Maul halten, belohnen Sie ihn am Anfang schon, wenn er nur daran riecht. Scheitert der Hund an einer Aufgabe, gehen Sie zurück in den "Kindergarten" und gestalten die Übung einfacher. Die Faustregel lautet: Wenn der Hund acht von zehn Versuchen meistert, können Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen.
Wie setzt man Belohnungen richtig ein?
Was eine Belohnung ist, entscheidet der Hund. Manche freuen sich über Streicheln, andere empfinden es als unangenehm und damit als Strafe. Für manche ist ein Spiel der beste Verstärker, andere reagieren am besten auf Futter. Wenn der Hund oft genug belohnt wird, braucht das Futter nicht übermäßig reizvoll zu sein. Muss ich den Hund allerdings mit Fleischwurst "bestechen", ist wohl einfach die Ablenkung zu groß und ich sollte lieber an der Trainingssituation arbeiten.
Wie sieht denn die ideale Trainingssituation aus?
Es ist wichtig, dass kein Zwang besteht. Ignorieren Sie Fehler einfach. Angst löst Stress aus, und unter Stress lernt es sich erwiesenermaßen schlecht. Aber langweilig darf es auch nicht werden! Tätigkeiten sind dann besonders befriedigend, wenn der Schwierigkeitsgrad hoch genug ist, um noch eine Herausforderung darzustellen, aber so niedrig, dass kein Frust aufkommt. So werden Konzentration und Wohlbefinden gesteigert.
Bei Menschen nennt man diesen Zustand Flow. Erleben Hunde das ebenfalls?
Ja. Das hat interessanterweise auch mit dem Dopamin zu tun. Früher dachte man, es wird vor allem bei Erfolg ausgeschüttet. Heute ist klar, dass es vermehrt in Erwartung einer Belohnung auftritt. Oder wenn etwas passiert, das vom Gehirn als neu, interessant oder besser als erwartet bewertet wird.
Wie merke ich, dass die Lernbereitschaft des Hundes nachlässt?
Er lässt sich viel schneller ablenken, schnüffelt oder bummelt herum. Stress zeigt er auch durch Körpersprache: zurückgelegte Ohren, Hecheln, straffe Gesichtshaut, Kopfschütteln, Schnauzelecken oder Kratzen. Es gibt aber auch Hunde, die bei Stress herumzappeln, alle Übungen durcheinander zeigen oder kläffen. So weit sollte es am besten nie kommen.
Warum sind Pausen so wichtig?
Gezieltes Training ist für Hunde eine relativ künstliche Angelegenheit und anstrengend. Schon nach ein paar Minuten sinkt die Konzentration, die Fehlerquote steigt und damit auch der Frust. Ich mache im Training meist nur fünf bis zehn Wiederholungen und lege dann eine kurze Pause von einer halben Minute ein. Das Gehirn nutzt die Pausen zum latenten Lernen.
Was geschieht beim latenten Lernen?
Zum einen sinkt der Stresslevel, wenn der Hund sich erholt. Zum anderen wird in Ruhephasen Gelerntes vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen. Sie werden häufig beobachten können, dass Ihr Hund nach einer Pause plötzlich Dinge umsetzen kann, die ihm zuvor noch Probleme bereitet haben. Als hätte es plötzlich Klick gemacht.

Strafen als Stressoren hemmen das Lernen. Würden Sie deshalb auf Strafe verzichten?
Der Haken am Lernen durch Bestrafung ist, dass man dabei sehr viel mehr falsch machen kann als bei positiver Verstärkung. Sie muss unter anderem zeitlich sehr exakt erfolgen. Nach etwa eineinhalb Sekunden kann der Hund die Strafe schon nicht mehr mit dem gezeigten Verhalten verknüpfen – selbst wenn er noch neben dem umgekippten Mülleimer steht. Belohnungen dagegen sind bei Weitem nicht so fehleranfällig.
Wie kann es sein, dass der Hund im Wohnzimmer perfekt hört, aber im Park nicht mehr weiß, was ich von ihm will?
Hunde sind schlechte Generalisierer. Mir geht es auch manchmal so, dass ich im Urlaub an einem fremden Geldautomaten meine Pin vergesse. Übt man immer nur im Wohnzimmer Sitz!, verknüpft der Hund nicht nur das Handzeichen und das akustische Signal mit dem Verhalten Hinsetzen, sondern auch diesen Raum, diesen Teppich und vielleicht auch den Geruch. Also verändert man die Situation in kleinen Schritten. Die gute Nachricht: Hunde lernen ebenfalls das Generalisieren. Das ist wichtig zu wissen, denn man kann sich ja schon sehr ärgern, wenn eine Übung zu Hause klappt und auf dem Spaziergang nicht mehr. Früher hieß es dann, der Hund wäre dominant.
Die unterstellte Sturheit ist ein Mythos?
Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es so ein Verhalten nicht gibt. Es würde ja bedeuten, dass der Hund die strategische Absicht hat, in diesem Moment nicht zu kooperieren. Das wäre viel zu komplex für ihn. Es muss also einen Grund geben. Er hat nicht verstanden, was Sie von ihm wollen, er ist verunsichert, abgelenkt oder hat vielleicht Schmerzen. Für Gehorsam braucht es nicht nur Verständnis, sondern auch Motivation. Wenn die Motivation fehlt, übt gerade etwas anderes einen stärkeren Reiz aus.
Trauen wir Hunden zu viel zu, was ihre kognitiven Fähigkeiten angeht?
Wir vermenschlichen sie oft. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass Hunde kein schlechtes Gewissen kennen, obwohl es ihnen häufig nachgesagt wird. In einem Versuch wurde Haltern gesagt, ihr Hund habe verbotenerweise ein Leckerchen geklaut – obwohl der Versuchsleiter den Keks genommen hatte. Die Besitzer haben anschließend in das Verhalten des Hundes ein schlechtes Gewissen hineininterpretiert, obwohl es nicht da sein konnte. Der Mensch sieht das, woran er glaubt.
Manche Verhaltensweisen können ganz schön verwirrend sein. Wie der Löschungstrotz, den Sie beschreiben …
Der setzt ein, wenn ein Hund umlernt. Sollte eine Familie am Esstisch etwa plötzlich aufhören, den Hund vom Tisch zu füttern, wird der wahrscheinlich eine Zeit lang noch stärker betteln als zuvor. Je unregelmäßiger er früher etwas bekommen hat, desto hartnäckiger wird er nun seinen Anteil einfordern. Das lässt sich nur aussitzen, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist.