Fotos: Coke Bartrina & Nuria Val
Bis vor drei Wochen hielt ich mich für ziemlich gefühlsschlau. Über die Jahre hatte ich mir eine seltsame Liebesarroganz angeeignet, die sich vor allem darauf stützte, was ich alles über Beziehungen gelesen, mit meinen Freunden besprochen und erlebt hatte. Ich habe diesen Gedanken natürlich nie bewusst gedacht, hätte ihn aber jederzeit unterschrieben: »Lieben? Das hab ich drauf!«
Ich trug diese Überzeugung in mir bis zu dem Nachmittag, als einer meiner besten Freunde mit hängenden Schultern neben mir auf der Couch saß. Er hatte mir eine Weile erklärt, wie es zwischen ihm und seiner Ex zum dritten und nun finalen Male gescheitert war, hatte die einzelnen Eskalationsmomente noch einmal aufgezählt, ich hatte viel genickt. Und trotzdem konnte ich beim besten Willen nicht begreifen, wieso diese Liebe nun endgültig vorbei sein sollte. Bei den beiden hatte es so viel und so wenig Streit gegeben wie in allen anderen Beziehungen, die ich kannte oder selbst geführt hatte. Es war kein großer Fremdgeh-/Gewalt-/Grundüberzeugungsskandal passiert, der alles nachweislich ruiniert hätte. Die Beziehung war ausgeplänkelt wie eine laue Stehparty. Und keiner wusste so genau, warum.
Statt ihn mit den üblichen Mutmachmantras zu beschwichtigen, starrte ich also wortlos in das langweilige, milchsuppige Grau des Hamburger Himmels, es vergingen fünf oder zehn Minuten, da hörte ich meinen Freund plötzlich diese irrsinnige Frage in die Stille des Raums stellen: »Sind wir vielleicht einfach beziehungsunfähig, Lena?« Und ich hörte mich antworten: »Ja, vielleicht.«
Ich war selten so hilflos, ängstlich, vor allem wütend wie in diesem Moment. Es war eine stille, nach innen gerichtete Wut, die auch Tage später noch in meinem Magen wühlte, durch meinen Kopf kroch, einfach nicht mehr verschwinden wollte. Wäre es nicht meine Pflicht als Freundin gewesen, ihm zu widersprechen, statt seine Hoffnungslosigkeit zu bestätigen? »Natürlich können wir das, Beziehung! Es hat halt noch keine gepasst! Und überhaupt, unser Glück liegt doch in uns selbst! Wir brauchen keinen anderen dafür!«
Nur: Ich glaube das eben nicht mehr. Ich glaube langsam, wir machen uns etwas vor. Es gibt einen Fehler im System unserer Beziehungen, eine falsche Variable in der Grundberechnung, irgendetwas, das immer wieder von links reingrätscht. Und das macht mir Angst.
Ein paar Tage vergingen, wenig Schlaf und viel schlechte Laune, ich rief meinen Freund an und sagte: »Ich werde noch einmal ganz neu klären, wie das mit der Liebe geht, wie wir das hinkriegen können: mit jemandem glücklich sein. Ich werde herausfinden, warum es bisher immer hakte. Und ich werde dir und mir diese Frage beantworten: »Kann man Lieben lernen?«
1. Bestandsaufnahme. Was sagt die Forschung?
Ich beginne meine Suche nach Antworten an einem Ort, der dafür bekannt ist, voller schlauer Gedanken zu stecken, der Bibliothek. Ich will Grundlagenforschung betreiben, ich will wissen, was uns überhaupt nach Liebe streben lässt. Und ob es das wirklich so häufig gibt: eine generelle Unfähigkeit, Beziehungen zu führen.
Das Thema scheint relevant zu sein. An den Hamburger Universitäten wurde in den vergangenen Jahren viel dazu geforscht. Ich wähle zwei Dissertationen aus, die sich mit der Entwicklung von Bindungsfähigkeit beschäftigen. Beide stützen ihre Forschungen auf die Theorie des Psychoanalytikers John Bowlby, der die Beziehungsfähigkeit als ein angeborenes Verhaltenssystem beschreibt. Also: Der Mensch kann gar nicht anders, als sich emotional an andere zu ketten. Auf welche Weise er dies tut, ist jedoch erlernt. Aus den Erfahrungen mit unseren ersten Bezugspersonen (meist Mutter oder Vater) entwickeln wir sogenannte Arbeitsmodelle, innerpsychische Strukturen. Der alte Hut: Wer konstant umsorgt wurde, baut ein tiefes Grundvertrauen auf, wer sich verunsichert fühlte, traut der Liebe anderer nicht. Bowlbys Kollegen Kim Bartholomew und Leonard M. Horowitz unterscheiden deshalb vier verschiedene Bindungsstile, in denen wir uns angeblich alle wiederfinden: Sichere Bindung (positives Selbstbild, positives Bild anderer, wenig Angst vor Beziehungen). Klammernde Bindung (negatives Selbstbild, positives Bild anderer, große Angst, andere in Beziehungen zu enttäuschen). Vermeidende Bindung (positives Selbstbild, negatives Bild anderer, wodurch die Angst entsteht, von anderen enttäuscht zu werden). Ängstliche Bindung (negatives Selbstbild, negatives Bild anderer, generelle Angst vor Beziehungen).
Heißt das also, die oft zitierte »schwere Kindheit« schwebt tatsächlich als nicht abzuwehrendes Damoklesschwert über unserem Lebensglück? Ich lese weiter. Nein, sagt die Forschung. Jede neue Beziehung bietet die Chance, die verinnerlichten Schemata umzuschreiben. Die Beziehungspersönlichkeit entwickelt sich ein Leben lang weiter. Beziehungskompetenz, schreibt etwa der Psychiater Joachim Bauer, können wir vor allem durch praktische Übung in folgenden Bereichen entwickeln: »Gemeinsame Aufmerksamkeit«, also sich dem zuzuwenden, wofür sich der andere interessiert; dazu kommt »emotionale Resonanz«, das Feingefühl, sich auf die Stimmung des anderen einzuschwingen; »gemeinsames Handeln« (hallo Hobbys!); und »grundsätzliche Kooperationsbereitschaft«, womit gemeint ist, freundlich zu sein, sich bei Unfreundlichkeit zwar zu wehren, danach aber nicht nachtragend zu sein.
Der Satz »Ich bin halt beziehungsunfähig« ist also, wenn er nicht gerade paartherapeutisch diagnostiziert wurde, aus wissenschaftlicher Sicht genauso liebesarrogant wie die Überzeugung, in Beziehungsdingen besonders gut zu sein. Die Forschung sagt klar: Es gibt immer Hoffnung. Aber man muss etwas dafür tun. Das klingt wie eine gute Botschaft, ist mir aber noch ein wenig zu platt. Und auch unvollständig: Ich hatte die beste Kindheit, die ich mir überhaupt vorstellen kann, und bin offenbar trotzdem irgendwie bindungsbehindert.
2. Ideale. Was sagt der Pop?
Es muss also an anderer Stelle haken. Liebe lernen wir schließlich nicht nur in der Familie. Wer schaut sich schon die Ehe seiner Eltern an und sagt: Genauso will ich es auch. Dann lieber: Neunzig Minuten Hollywood, Beziehungen voller Dramen und großer Gefühle. Filme, Romane, Musik – unsere Maßstäbe an Romantik sind spätestens ab der Pubertät fast ausschließlich fiktionalen Ursprungs. Interessant daran: Die meisten Geschichten, die uns die Popkultur erzählt, sind nicht ansatzweise so emanzipiert, wie es heutzutage eigentlich erwünscht ist. Immer noch erobert in den meisten Filmen der Mann die Frau, Menschen singen in Balladen übereinander, dass das Leben ohne den anderen nicht lebenswert wäre, in Romanen gelingt Liebe entweder überhaupt nicht oder immer gleich sehr kitschig. Das Mittelmaß, ohne das kein Mensch ein Leben lang Beziehungen aushalten würde, kann und muss die Kunst nicht interessieren. Uns aber schon.

Den schönsten, möglicherweise wahrsten Text über Liebe finde ich deshalb nicht bei den Romantikern, den Sturm-und-Dränglern oder in einem Whitney-Houston-Song, sondern im hinteren Drittel eines schmalen Romans aus dem Jahr 2006. Moritz von Uslar schreibt in »Waldstein oder der Tod des Walter Gieseking am 6. Juni 2005« über das, was Beziehungen brauchen, um zu halten: »Achtung für den anderen – stille, wahre, einzige Liebe, die diesen Namen verdiente. Nach dem Sex, eine Art Guten-Tag-Sagen zwischen Mann und Frau, musste die Lust am Zuhören kommen, an den Eigenheiten des Gehirns des anderen, dann, wieder später, die Freude an seiner schweigsamen Anwesenheit, dann, viel später, mit achtundsechzig, siebzig, achtzig, nochmal gruselige Alterssexfreuden, eine Art Gute-Nacht-Sagen, Ausdruck dafür, dass das Fleisch ja immer auch mitreden wollte, alles entschuldigt, alles voll okay. So in etwa stellte Gieseking sich das vor. Dass man mal Strecke machte, Raum gewann, zehn, zwölf, zwanzig, fünfzig Jahre zusammenblieb. Die gesammelten Jahre, in denen man sich immer wieder aufs Neue nicht getrennt hatte, mussten ein eigener Wert, mussten der ganze Sinn der Sache werden.«
Das klingt nur im ersten Moment langweilig. Eigentlich heißt es: Wenn das mit der Liebe funktionieren soll, musst du nicht weniger investieren als dein ganzes Leben. Das ist vielleicht nicht in den einzelnen Momenten, spätestens aber in der Rückschau der höchste Einsatz überhaupt, die romantischste Idee von allen, ganz großer Glamour.
3. Praktisch. Was sagt die Psychologie?
Wie aber sollen wir die Romantik des Bleibens aushalten? Mehr noch, sie währenddessen sogar gut finden? Ich rufe den Münchner Psychoanalytiker und Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer an. Schon seine Stimme macht mir gleich gute Laune. Schmidbauer ist heiter und optimistisch, obwohl oder gerade weil er sich seit Jahrzehnten mit der Beziehungs(un)fähigkeit der Menschen beschäftigt, zahlreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben hat (unter anderem »Coaching in der Liebe«) und noch heute täglich mit Paaren spricht, die in seiner Praxis nach Antworten auf ihre Beziehungsfragen suchen. Gerade eben, sagt er, sei eine Patientin da gewesen, die sich schrecklich über die Lethargie ihres Mannes beklagt habe. Sie selbst würde den gesamten Haushalt schmeißen, alles organisieren, vom Urlaub bis zum Dinnerabend mit Freunden. Und er? Mache nichts. Für mich klingt das nach den typischen Beziehungslappalien, aber wie oft hat man schon gehört, dass genau solche Miniaturstreitpunkte irgendwann den großen Knall verursachen. »Was haben Sie ihr geraten?«, frage ich Schmidbauer. »Ich habe ihr gesagt, dass sie richtig, richtig froh sein kann, einen faulen Mann zu haben. Wäre sie mit jemandem zusammen, der genauso kontrolliert und strukturiert ist wie sie, würden sich die beiden früher oder später zerfleischen.« Wie lautet also der konkrete Rat für diese Frau? »Sie kann sich natürlich von ihm trennen. Aber ich denke, es wäre sinnvoller, zu lernen, seine Marotten auszuhalten«, sagt Schmidbauer. »Aushalten« und »ertragen«, das sind die beiden Worte, die in unserem Gespräch immer wieder fallen. Liebe selbst müsse man nicht lernen, sagt Schmidbauer, zu lieben, sei eine menschliche, spontane Reaktion, die könne man gar nicht abschalten. »Was Sie eigentlich wissen wollen, ist, wie man die Liebe stabilisiert.« Und das, sagt Schmidbauer, funktioniere vor allem darüber, sich und den anderen unvollkommen zu lassen. »Das ist schwer für Ihre Generation. Sie haben gelernt, sich für Ihr Lebensglück einzusetzen, aktiv zu sein. In der Liebe geht es aber ganz oft um Passivität. Darum, nicht immer gleich zu handeln, sich nicht zurückzuziehen, Kränkungen auch mal auszuhalten, nicht andauernd in Beleidigungskonkurrenz zueinander zu treten.« Sind wir also weltfremd, was unsere Zuneigungserwartungen angeht? »Nein«, sagt Schmidtbauer, »aber es geht nicht immer nur um Sie. Viele Menschen sehen Liebe insgeheim als eine Art Leistung, die vom andere gefälligst erbracht werden soll. Sie denken: Ich mache so viel, ich habe mich so gut im Griff, ich arbeite andauernd an mir, also steht mir das auch zu, ich habe es verdient, geliebt zu werden. In Wahrheit wird aber andersherum ein Schuh draus: Lieben macht liebenswert.«
Wenn er die Krux an heutigen Beziehungen beschreiben solle, sagt Schmidbauer, falle ihm deshalb immer ein Bild der Zeichnerin Doris Lerche ein. Es zeigt ein Paar auf der Couch. Sie sagt: »Ich möchte mal so richtig geliebt werden.« Er: »Ich auch.«
4. Maßstäbe. Was sagt die Kirche?
Ich möchte jetzt unbedingt mit jemandem sprechen, der es nicht andauernd mit kaputten, sondern mit – zumindest für den Moment – intakten Beziehungen zu tun hat. Weil meine Eltern und ich, seit ich denken kann, mindestens einmal im Jahr Urlaub auf Sylt machen und meine Mutter gerne scherzhaft sagt, es sei ihr im Grunde egal, wen ich heirate, das Wo allerdings sei nicht verhandelbar, bitte ich Susanne Zingel um ein Gespräch. Zingel ist seit 2005 Pastorin in der Sankt-Severin-Kirche im Sylter Romantikort Keitum. Hier scheint die Frage noch dringlicher: Wieso machen wir es uns mit der Liebe heute so schwer?
Ein großes Problem, sagt die Pastorin, sei, dass die Menschen heute oft den Anspruch hätten, in jedem Moment eine perfekte Beziehung zu führen, was schlichtweg unmöglich sei. »Ich erinnere dann gerne an den Frank-Sinatra-Satz, der einen sehr christlichen Gedanken transportiert: »The Best Is Yet to Come«. Einfach mal auf das Gute vertrauen. Und wahrscheinlich kann dieser Satz tatsächlich helfen, weil Susanne Zingel daran glaubt, dass in Liebesdingen niemand je ganz verloren ist. Über 700 Paare hat sie schon getraut, etliche Silber- und Goldhochzeiten erlebt. Wie reden Menschen, die sich bald das Jawort geben wollen, und solche, die es nie gebrochen haben, voneinander? Gibt es einen Schlüsselsatz der Glücklichen? »Im Gegenteil, die Menschen sind erstaunlich sprachlos, wenn man sie fragt, weshalb sie sich füreinander entschieden haben«, sagt Zingel. Wenn überhaupt, wählten sie schlichte Antworten, bekannte Bilder: »Er ist mein Fels in der Brandung« oder: »Ihr Temperament ist eine ständige Herausforderung für mich«. Oder umgekehrt. »Das klingt erst einmal abgeschmackt, ist aber ein gutes Indiz. Zu wissen, wer der andere ist und was ich nur in der Kombination mit ihm sein kann – das ist schon viel wert«, sagt Zingel.
Ich finde diesen Gedanken interessant. Wir haben gelernt, uns gegen »Schubladen« zu wehren, in die wir gesteckt werden sollen. Wir haben den Anspruch, jede Rolle unseres Lebens selbst spielen zu können. Liebe, die eine stabile Beziehung ergeben soll, bedeutet aber auch, sich für den anderen ein Stück weit berechenbar zu machen. »Von den Fels-Brandung-Paaren gab es vor fünfzehn, zwanzig Jahren noch mehr. Ich hatte bei ihnen immer ein ganz gutes Gefühl«, sagt Zingel. Es ist doch eigentlich auch eine schöne Idee: etwas sein zu wollen – für den anderen. Das muss ja nicht immer gleichbedeutend sein mit Selbstaufgabe. Am Ende, sagt sie, sei es schlicht eine Frage des Mutes. »Uns wird beigebracht, Zufriedenheit in uns selbst zu finden, uns unabhängig zu machen, in jeder Hinsicht. Und das ist auch gut so. Aber Liebe heißt nun mal, sein Glück in die Hand eines anderen zu legen.«


5. Ergebnis. Ertragt euch!
Zwei Wochen später. Ich sitze zwischen Sachbüchern, ausgedruckten Dissertationen, Interviewaufzeichnungen, versuche eine Ordnung zu finden. Lese noch einmal die rot umkringelten Sätze, bleibe hängen an Wolfgang Schmidbauers Aufruf, passiver zu sein, das eigene Glück nicht andauernd aktiv erarbeiten zu wollen, überfliege den Aufsatz des 30-jährigen Neuroethikers Brian D. Earp, der fordert, eingeschlafene Beziehungen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten neu zu entflammen (Oxytocin, ein Hormon, das unter anderem beim Orgasmus ausgeschüttet wird, könnte seiner Meinung nach künstlich hergestellt ganz prima als Nasenspray verabreicht werden).
Ich habe viel Negatives gehört in den vergangenen Tagen – aber komischerweise fast nur von mir selbst. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren sich sicher, dass es einen Weg gibt, mit der Liebe ins Reine zu kommen. Wenn ich ihre Hinweise zusammennehme, ist die Strategie sogar eindeutig. Populär ist sie allerdings nicht.
»Liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest« oder: »Erst wenn du ganz bei dir bist, bist du bereit für eine Beziehung« – wer sich mit der modernen Ratgeberliteratur beschäftigt, muss sich anhören, Liebe sei etwas, für das man selbst »fertig« sein muss. Das ist kompletter Unsinn. Wer lieben will, muss sich zuallererst seine eigene Bedürftigkeit eingestehen. »Ich brauche dich«, »Wir sind zu zweit besser, als ich es alleine je wäre« – alles Sätze, für die wir uns zu schämen gelernt haben. Und genau da liegt unser blinder Fleck. Wir wissen, dass die Ehen unserer Eltern und Großeltern immer auch über wirtschaftliche, gesellschaftliche, moralische Abhängigkeit funktionierten, gestatten uns selbst aber nicht einmal, uns emotional aneinanderzuketten. Wie kamen wir nur auf die Idee, verbindliche Bindungen nicht mehr nötig zu haben?
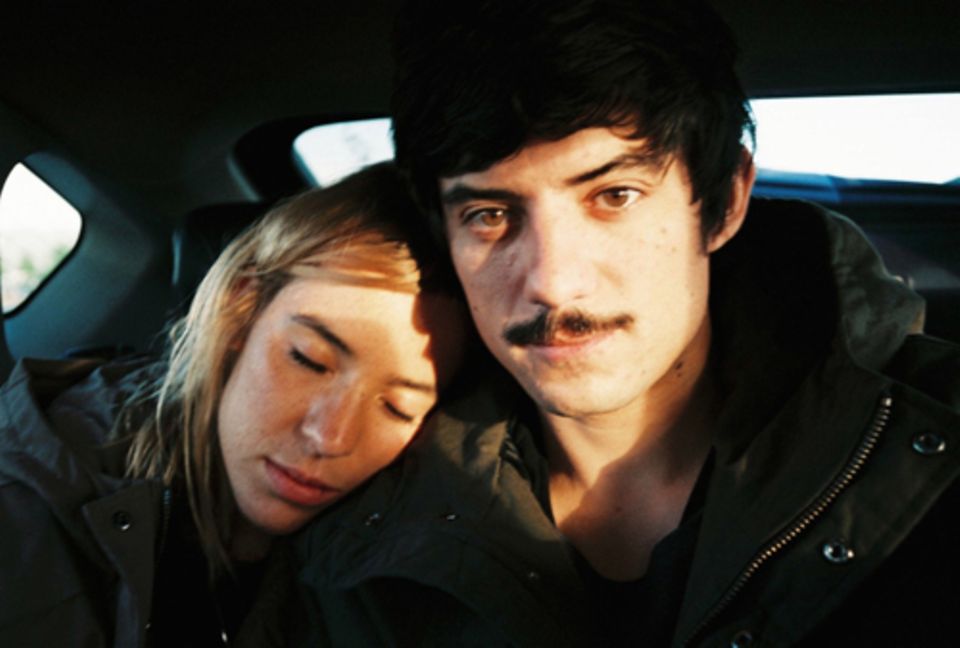
Wenn wir die romantische Liebe ersehnen, die über Jahrzehnte andauert, müssen wir endlich von uns selbst ablassen. Mehr noch: Wir müssen bereit sein, uns hin und wieder aufzugeben, oft zu kurz zu kommen, den anderen zu beschützen – auch vor uns. Nicht als Opfer, sondern als (Hin-)Gabe an die Beziehung. Das klingt nicht schick und nicht modern und es sollte auch nicht existenzbedrohend werden. Aber wenn mich in Zukunft ein Freund fragt, ob er beziehungsunfähig sei, werde ich sagen: »Ja, vielleicht. Wahrscheinlicher ist aber, dass du dich selbst zu wichtig nimmst. Romantik, guter Sex, verliebte Blicke? Gehört auf jeden Fall dazu. Viel entscheidender aber ist: Wort halten, knallharte Beharrlichkeit, offene Verletzlichkeit und, ja, komplett ernst gemeinte emotionale Abhängigkeit.«
Susanne Zingel, die Sylter Pastorin, hatte mir zum Abschied ein Zitat mit auf den Weg gegeben: »Die Liebe, die uns entgegengebracht wird, verpflichtet uns zu nichts.« Das stimmt. Aber ich finde, wir sind der Liebe mal wieder etwas schuldig.
Dieser Text ist in der Ausgabe 03/16 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte nachbestellt werden. NEON gibt es auch als eMagazine für iOS & Android. Auf Blendle könnt ihr die Artikel außerdem einzeln kaufen.






