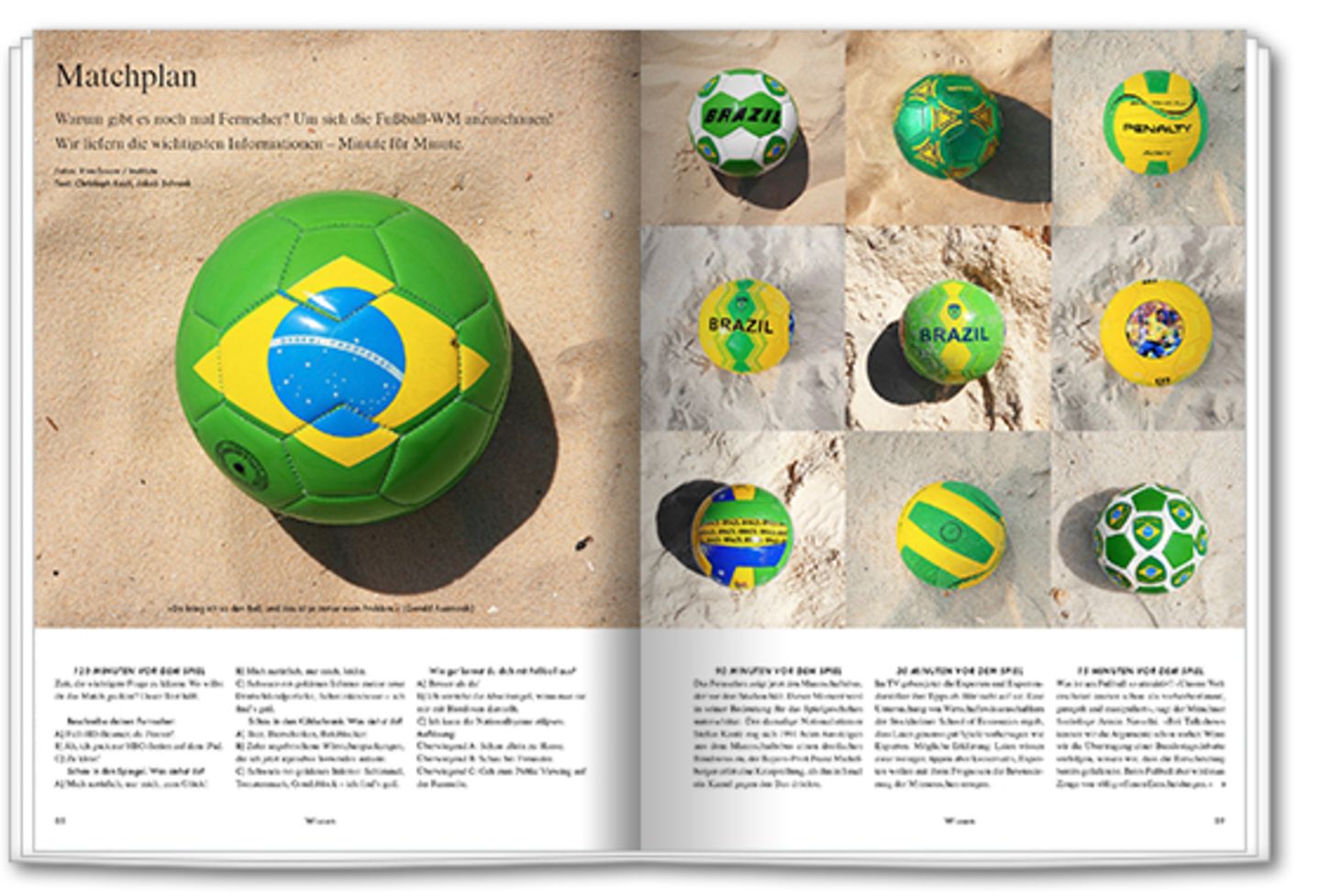»Die Wahrheit liegt auf dem Platz« soll Otto Rehhagel einmal gesagt haben. Damit meinte er, dass letztlich eben nur das Spiel selbst zählt, dass es auf das Ergebnis ankommt und sonst nichts, und dass es daher ziemlich unnütz ist, im Vornherein über ein Match zu spekulieren oder es im Nachhinein zu analysieren. Ich glaube, Otto Rehhagel irrt sich zwar fast nie, da aber schon. Tatsächlich liegt die Wahrheit neben dem Platz.
Ich würde fast schon sagen, dass mich das Spiel selbst viel weniger interessiert als das ganze Gerede drum herum. Mit meinen beiden besten Freunden, Tobias in der NEON-Redaktion und Heiner, der zum Glück woanders arbeitet, rede ich fast ausschließlich über Fußball. Seriös geschätzt verbringen wir etwa neunzig Prozent der Zeit, die wir miteinander haben, damit, über die Dreierkette zu sprechen. Wir diskutieren darüber, warum Jürgen Klopp so unfassbar nervt, warum die falsche Neun eigentlich absolut richtig ist, wieso nur Idioten nicht einsehen, wie genial Toni Kroos wirklich ist und darüber, dass eigentlich alle Fußballfans unfassbar nerven – außer halt wir selbst.
Warum beschäftigen wir uns überhaupt so intensiv mit einer so unwichtigen Sache? Ich fürchte, darauf gibt es keine Antwort. Aber vielleicht lässt sich immerhin erklären, warum man so unfassbar gut über Fußball reden kann. Und über Fußball reden ja jetzt, zu WM-Zeiten, ja wirklich alle und immer und überall.
Über dieses Thema habe ich mit dem Literaturwissenschaftler Matias Martinez gesprochen. Martinez ist Professor an der Universität Wuppertal und hat den sehr empfehlenswerten Sammelband: »Warum Fußball?« herausgegeben. Martinez meint, dass am unendlichen Gerede über Fußball letztlich ich und meine Kollegen schuld sind. Er sagt:
»Wir werden nie unmittelbar mit Fußballspielen konfrontiert. Sie begegnen uns stets eingebettet in eine Vielzahl von Texten – Vorberichterstattungen, Live-Reportagen, nach dem Spiel die Analysen, Kommentare, Interviews, Statistiken. Das physische Geschehen auf dem Rasen ist dadurch zunächst einmal besser zu verstehen – damit wird ein intellektuelles Bedürfnis nach Erklärung des Gesehenen erfüllt.«
Aber das Gerede über den Fußball wäre wohl nur halb so interessant, wenn man wirklich immer nur darüber reden würde, ob das Tor von Mats Hummels im Pokalfinale gegen Bayern München nun drin war oder nicht, warum das Dortmunder Mittelfeld zu wenig pressingresistent ist, ob Klose nun noch fit wird und warum der »inverted winger« vielleicht doch keine gute Idee sein könnte. Tatsächlich wird Fußball mit kulturellen Mythen aufgeladen. Martinez sagt:
»Ein Spiel ist mehr als regelgeleiteter Wettkampf zwischen 22 Personen. Die Spieler auf dem Platz symbolisieren zugleich auch Vereine, Städte und Nationen mitsamt ihren Mythen und Geschichten. Da tummeln sich natürlich Klischees: Der ehrliche Arbeiterfußball der Dortmunder gegen die blasierten Millionäre aus München, die ballverliebten Brasilianer gegen die nüchternen Deutschen.«
Indem wir über Fußball reden, verwandeln wir also den Fußball, wir machen aus dem Geschehen aus dem Platz – 230 absolvierte Laufkilometer, 1100 gespielte Pässe, davon 240 Fehlpässe, sechs gelbe Karten – eine in sich konsistente Erzählung, die mehr mit uns und mit unseren psychologischen Strukturen zu tun hat als mit dem, was da eigentlich tatsächlich geschehen ist. Auch dabei spielen Journalisten wieder eine wichtige Rolle. Der Moderator erzählt ja Millionen von Menschen, was sie da eigentlich gerade wirklich sehen, wenn sie fernsehen, und sogar die Menschen, die im Stadion sitzen, haben ja davor Zeitung gelesen oder Radio gehört oder auf Sportseiten im Internet ihre Zeit verschwendet (oder sie haben zumindest mit anderen Leuten geredet, die genau das getan haben). Martinez sagt:
»Um dem komplexen Gewusel auf dem Rasen eine prägnante Gestalt zu geben, inszenieren Reporter Fußballspiele als Dramen: Sie heben aus den Beteiligten (Spieler, Schiedsrichter, Trainer usw.) einzelne als Protagonisten heraus, verknappen den Mannschaftskampf zum Antagonismus zwischen einzelnen Spielern, psychologisieren die physischen Aktionen als Ausdruck und Folge von Gemütszuständen, akzentuieren den Spielverlauf durch die Hervorhebung von Höhe- und Wendepunkten. Und der individuelle Spielverlauf wird unter bestimmte Handlungsschemata gebracht, die kulturell bedeutsam sind: Der Außenseitersieg als Kampf Davids gegen Goliath, die rote Karte als verhängnisvoller Fehler des tragischen Helden, die Elfmeterschwalbe als tückische List des Bösen.«
Die Art und Weise, wie wir über Fußball reden, unterscheidet sich also kaum von der Art und Weise, mit der sich Menschen seit Jahrtausenden Geschichten erzählen. Und auch die Funktion dieses Geredes ist im Grunde gleich, so Martinez:
»Das Erzählen generell so wie auch Fußballerzählungen stiften Gemeinschaft und Identität: Fußball liefert endlosen und jedermann zugänglichen Gesprächsstoff für die Mittagspause im Betrieb. Man tauscht dabei nicht nur Informationen aus, sondern vor allem bestätigt und verstärkt man so seine sozialen Beziehungen. Außerdem tragen Fußball-Erzählungen zur Identität von Einzelnen und von Gruppen bei: Die eigene Lebensgeschichte wird mit der Erinnerung an bestimmte Spiele verwoben (»Das Endspiel 1954 habe ich damals zuhause mit meinen Eltern am Radio gehört‘«), berühmte Länderspiele sind Teil der Populärkultur, die kulturelle Gemeinschaften wie Nationen jeweils prägen.«