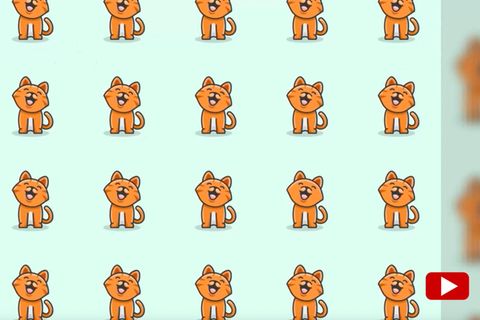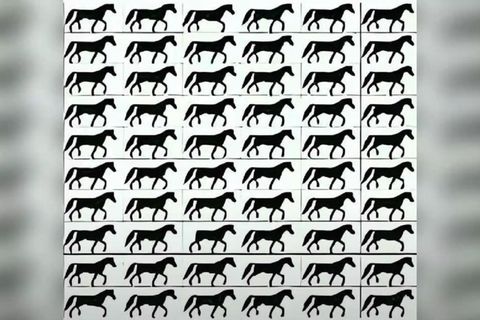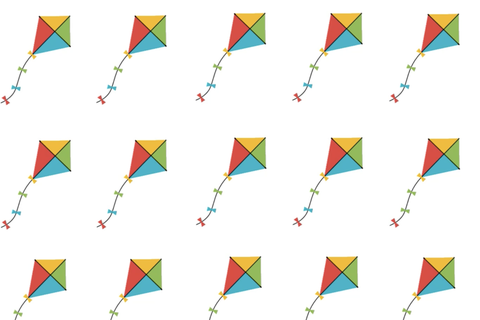Blinde wieder sehen lassen - diesem Ziel sind Forscher jetzt ein Stück näher gekommen. Die Wissenschaftler um Eberhart Zrenner von der Universität Tübingen pflanzten in einer Pilotstudie Blinden, die an einer erblich bedingten Augenkrankheit erkrankt sind, einen Netzhaut-Chip ein. Mit seiner Hilfe konnten die Teilnehmer diverse Sehaufgaben erfüllen, etwa Lichtquellen erkennen oder verschiedene Gegenstände auf einem Tisch lokalisieren. Die Ergebnisse von drei Patienten präsentierten die Wissenschaftler in einer Studie, die in der aktuellen Ausgabe des Journals "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht wurde.
Vor allem ein Patient - Miikka - zeigte demnach in den Sehtests erstaunliche Ergebnisse. Er konnte nicht nur Gegenstände wie Löffel, Gabel, Tasse und eine Banane orten und beschreiben; es gelang ihm auch 16 verschiedene Buchstaben voneinander zu unterscheiden. Als die Forscher ihm die weißen Buchstaben "M-I-K-A" auf einen schwarzen Tisch legten, wies er sie darauf hin, dass sein Name falsch geschrieben worden sei. Miikka war als Einzigem der Chip direkt unter den Gelben Fleck implantiert worden. Dieser Bereich der Netzhaut ermöglicht das schärfste Sehen.
Der von den Forschern entwickelte Chip ist nur drei Mal drei Millimeter klein und hauchdünn. Er wird direkt unter die Netzhaut gesetzt. Wenn Licht auf die 1500 Photodioden des Chips fällt, wird dies über einen Verstärker an die Nervenzellen der Netzhaut geleitet. Im Anschluss werden die Signale zum Sehzentrum geschickt.
Chip hilft bei erblicher Netzhauterkrankung
Der Netzhaut-Chip ist nur für Menschen geeignet, die früher schon einmal sehen konnten - denn die Verarbeitung der Bildinformationen im Gehirn muss bereits gelernt worden sein.
Die Studienergebnisse könnten den Forschern zufolge dabei helfen, den erblich bedingten Netzhautrückgang (Retinitis pigmentosa) zu heilen. Nach Angaben des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands leiden hierzulande 30.000 bis 40.000 Menschen unter dieser Krankheit. "Davon könnte den fortgeschrittenen Fällen eine gewisse Sehleistung wieder gegeben werden", so die Forscher.
Studienleiter Zrenner ist Gründer einer Firma für Sehprothesen und Leiter des Forschungsinstituts für Augenheilkunde an der Universität Tübingen. Der Chip soll nach der Beendigung der Hauptstudie mit 25 Patienten marktreif sein. Wie teuer er dann sein wird, ist den Wissenschaftlern zufolge noch unklar.