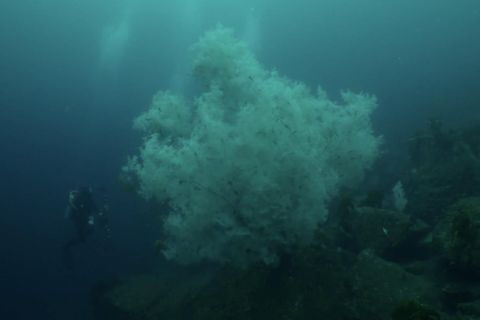Sergej Zimov hat einen ehrgeizigen Plan: Der russische Biologe will in Sibirien die Gras-Steppe des Pleistozäns wiedererschaffen, eine Epoche der Erdgeschichte, die vor mehr als 10.000 Jahren endete. Damals überzogen noch weite Graslandschaften Sibirien. Mammuts, Wollnashörner, Bisons, Pferde, Moschusochsen, Rentiere und Elche grasten dort. Sie, so glaubt Zimov, waren damals ein entscheidender Faktor für die klimatischen Verhältnisse in Sibirien. Seine Theorie: Die weidenden Tiere sorgten dafür, dass junges, saftiges Gras nachwachsen konnte. Doch dann habe der Mensch die Tiere entweder ausgerottet oder aus der Gegenden verdrängt. Die Folge: Das Gras wurde nicht länger gefressen, sondern starb ab, bedeckte und erstickte nachwachsenden jungen Halme. Eine von Moosen und Sträuchern dominierte Tundra habe dann die einstige Gras-Steppe überzogen. Schließlich seien Sümpfe entstanden, die im kalten Klima Sibiriens zu Permafrostböden gefroren seien. Eine Entwicklung, die Zimov jetzt wieder rückgängig machen möchte.
Elche für den Klimaschutz
"Pleistozän-Park" nennt der Forscher sein ambitioniertes Projekt in Anlehnung an den bekannten Dinosaurierfilm "Jurassic-Park". Der Park ist 160 Quadratkilometer groß und liegt in der Republik Sacha in Nordost-Sibirien. Hinter hohen Zäunen grasen dort zurzeit 50 Tiere: jakutische Wildpferde, Rentiere und Elche. In den nächsten Jahren soll der Bestand auf rund 400 Tiere anwachsen, um so den Beweis zu erbringen, dass sich Tundra wieder in Grasland zurückverwandeln lässt. Doch Zimov verspricht sich noch mehr von seinem Projekt. Der Park soll auch den Klimaschutz voranbringen. Der Wissenschaftler glaubt, dass die Pflanzenmasse der Grasnarbe mehr von dem Treibhausgas Kohlendioxid binden kann als die moosige Tundra. Mehr noch: Zimov ist überzeugt, dass "eine Rekonstruktion des Graslandes das Auftauen des Permafrostbodens verringern und so einige negative Konsequenzen der Klimaerwärmung lindern könnte."
Außerdem reflektiere eine helle Steppe mehr Sonnenlicht als eine dunkle Moorlandschaft, meint Zimov. Dadurch würde sich der Boden nicht so stark erwärmen. Denn je schneller die Permafrostböden schmelzten, desto mehr klimaschädliches Kohlendioxid und Methan würde beim Auftauen freigesetzt.
Um Zimovs Theorie verifizieren zu können, wird noch in diesem Jahr mit dem Bau einer großen Klima-Mess-Station begonnen. Dort wollen er und sein Team herausfinden, wie sich das beweidete Gebiet von naturbelassener Tundra unterscheidet: "Da andere Forscherteams in herkömmlichen Ökosystemen in der Tundra mit derselben Ausrüstung arbeiten, wird es möglich sein, die Effekte der Klimaerwärmung an verschiedenen Ökosystemen miteinander vergleichen zu können," erklärt der Forscher. Gemessen werden soll zum Beispiel, ob die Böden wirklich langsamer abschmelzen und wie viel Treibhausgas pro Fläche emittiert wird.
Zimovs Park ist unter seinen Kollegen nicht unumstritten. Bereits vor einem Jahr äußerten sich verschiedene Wissenschaftler zu seinem Projekt: Einige reagierten mit Interesse, andere lehnten die Idee ab, darunter der Paläontologe Adrian Lister, Professor am University College in London. "Die These, dass jene Tiere nur durch den Menschen ausgestorben sind, ist zuviel des Guten.", sagte Lister in einem BBC-Interview. Die Zahl der Menschen in Sibirien sei dafür viel zu gering gewesen. "Zimov spricht von einer Auslöschung von Millionen großer Tiere wie Wollnashörner und Mammuts. Selbst wenn die Menschen dort die Kapazität besessen haben sollten, so viele Tiere umzubringen, wieso hätten sie das tun sollen?"
Die Rückkehr des sibirischen Tigers
Doch allen Kritikern zum Trotz komme das Projekt in Sibirien nun langsam voran, berichtet Sergej Zimov. Vergangenes Jahr habe er zusammen mit seinem Kollegen die ersten Rentiere nach Sacha gebracht. Sie hätten sich gut akklimatisiert und sich bereits fortpflanzen können. Allein die Wiederansiedlung der Elche sei komplizierter gewesen. "Da sie in dieser Region so gut wie ausgestorben sind, war es schwierig, einige wenige Exemplare zu finden, einzufangen und in unseren Park zu bringen. Ihre Zahl wächst jedoch glücklicherweise. Wir fanden Spuren von neugeborenen Elchen in unserem Park" berichtet Sergej Zimov.
Auch Raubtiere, wie Bären und Luchse befinden sich bereits im Park. Sie sollen dort in Zukunft den Tierbestand gesund halten, indem sie schwache und kranke Tiere jagen und töten. Bisher allerdings leben die Tierarten in separat abgezäunten Bereichen und sollen erst nach einer Vergrößerung der Populationen und der Fläche vereint werden. Falls aber alles nach Plan läuft, werden in fünf bis sieben Jahren sogar wieder sibirische Tiger durch den Park streifen.