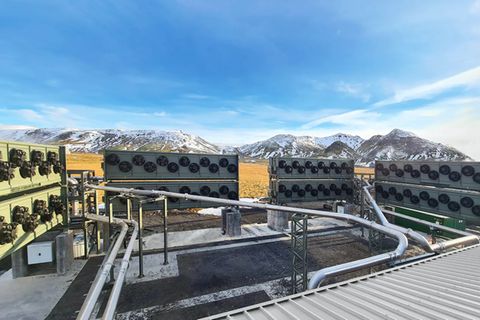Lieber Lottoglück als Geldanlage - unter diesem Motto könnte man durchaus den Umgang der Deutschen mit Geld sehen. Denn während gerade die Annahmestellen gestürmt wurden, um den Rekord-Jackpot zu knacken, lassen die Bundesbürger von gedeihlichen Geldanlagen die Finger. Schade, denn mit ein wenig mehr Wissen könnte für die meisten Sparer weit mehr als bisher dabei herausspringen - auch ohne Losglück. Wie es funktionieren kann, erklärt Rüdiger von Nitzsch, Wirtschaftsprofessor an der RWTH Aachen.
Herr von Nitzsch, für den Lotto-Jackpot riskieren die Deutschen fast alles, ansonsten hängen sie am Sparbuch - und verschenken damit Jahr für Jahr Geld. Warum tun wir uns so schwer mit rentierlichen Geldanlagen?
Ein Großteil der Bevölkerung verbindet Aktieninvestments immer noch mit so etwas wie "Spekulation" und einem "sehr riskantem Spiel", von dem man schlichtweg zu wenig Ahnung hat. Man fühlt sich unsicher, weil es noch etwas Neues und Undurchschaubares ist. Und man hat Angst, dabei viel Geld verlieren zu können. Bei Lotto ist das etwas ganz anderes. Erstens ist es ein bekanntes Spiel, bei dem man alle Einflussfaktoren kennt. Zudem "verliert" man kein Geld, sondern kauft sich etwas, und zwar das Los. Entscheidender Treiber bleibt aber der Traum nach dem vielen Geld, den man sich vielleicht verwirklichen kann.
Mehr zum Thema...
... lesen Sie im aktuellen stern mit dem Journal "Geld 2008".
Ist Geldanlage-Erfolg planbar, wissenschaftlich fundiert?
In der Tat ist die Geldanlage ein zentrales Gebiet in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, in der auch schon einige Nobelpreise vergeben wurden. Zu erwähnen sind hier insbesondere die theoretischen Überlegungen von Harry M. Markowitz, der ein mathematisches Modell entwickelt hat, mit dem man Risiken minimieren kann, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen. Nach seiner heute breit anerkannten Theorie muss jeder Anleger darauf achten, dass er Investments in verschiedenen Vermögensarten tätigt und hierbei das Risiko in bestimmter Weise streut.
Die Börse dürfte den meisten Verbrauchern ein ziemliches Rätsel sein. Wie viel Prozent der Kursentwicklung ist wirtschaftlich begründet, wie viel psychologisch?
Es ist zwar schwierig, das exakt in Prozenten anzugeben, aber grob abgeschätzt könnte ich der Aussage zustimmen, dass ca. 80 bis 90 Prozent der Kursbewegung auf psychologische Effekte, wie beispielsweise unterschiedliche Stimmungen oder variierende Risikobereitschaft, zurückgeht und die verbleibenden zehn bis 20 Prozent auf Veränderungen in den fundamentalen Faktoren, wie Gewinnerwartungen bei den Unternehmen oder auch die Zinsen.
Zur Person
Prof. Dr. Rüdiger von Nitzsch lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Entscheidungsforschung und Finanzdienstleistungen an der RWTH Aachen. Er ist zudem Vorstand des Aachener Forschungsinstituts für Asset Management (FIFAM).
Wie kann man an der Börse mitverdienen, ohne gleich sein ganzes Hab und Gut zu riskieren?
Man muss zunächst einmal genau überprüfen, wie viel Risiko man in seiner Geldanlage eingehen sollte. Hierbei ist zum einen die finanzielle Situation zu betrachten, aber auch die eigene Psyche, das heißt die Frage, wie gut man Risiken ohne Stress verkraften kann. Daneben ist auch der Anlagehorizont zu berücksichtigen: Je länger man auf das Geld verzichten kann, desto mehr Risiko kann man grundsätzlich tragen. Kennt man das Risiko, welches man verkraften kann, dann sucht man sich eine Anlage, die in verschiedene Anlageklassen - wie Aktien, Zinspapiere, Immobilien - direkt oder indirekt investiert und eine gute Risikostreuung aufweist.
Wie viel Rendite lässt sich eigentlich bei mittelgroßem Risiko erzielen?
Nahezu risikolos liegen die Renditeerwartungen zurzeit bei vielleicht vier Prozent, ohne zu große Risiken einzugehen kann man hier noch zwei bis drei Prozent drauflegen. Allerdings sind dies Bruttowerte, also vor Steuern. Je nach steuerlicher Situation reduziert sich die Rendite dann noch. Man beachte allerdings, dass die zu erwartende Rendite stark davon abhängt, wie viele Gebühren, beispielsweise fürs Management, der Anbieter verlangt. Hier sollte man also ein kritisches Auge haben.
Was ist von so genannten "Alternativen Investments", wie zum Beispiel Gold oder andere Rohstoff-Anlagen oder Hedgefonds, zu halten?
Für Anleger mit etwas mehr Geld, sagen wir ab 100.000 Euro anzulegendem Geldvermögen, ist es durchaus sinnvoll, auch in solche Investments zu gehen. Hierdurch lässt sich das Gesamtrisiko noch besser streuen. Bei einem geringen Vermögen sollte man lieber bei den klassischen Anlageformen wie Renten-, Aktien- und Immobilienfonds oder entsprechenden Dachfonds bleiben.