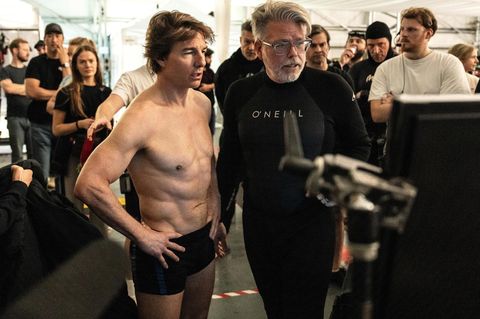Bei den Exportbranchen Auto, Maschinenbau und Chemie werden angesichts des aktuellen Kursniveaus von 1,17 Dollar die Sorgenfalten tiefer. Die Aufwertung des Euro gegenüber der wichtigsten Welthandelswährung verteuert tendenziell die Produkte "Made in Germany" und drosselt zumindest die erhofften Gewinnspannen.
Wenigstens werden Importe billiger
Die Volkswirte der Deutschen Bank sowie der Frankfurter Deka-Bank sehen in zwölf Monaten die Kursrelation schon bei 1,25 Dollar. Dies verbilligt zwar die Importe - insbesondere die Einfuhr von Energie. Der dringend benötigte Exportschub nach drei Jahren Stagnation und extrem schwacher Binnennachfrage wird damit allerdings gebremst.
Abwertung zur Lösung eigener Probleme
Die neuerliche Euro-Stärke ist aber nur Ausdruck der akuten Dollar-Schwäche. Die amerikanische Politik sieht in der Abwertung ihrer Währung offenbar das letzte Mittel, die enormen wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Da das Zinspulver mit einem Leitzins von nur noch 1,0 Prozent verschossen ist, soll der Export mit dem Rückenwind eines billigen Dollar angekurbelt werden. Neben dem - von Militärausgaben und Steuersenkungen - in die Höhe getriebenen Staatsdefizit krankt die US-Ökonomie zusätzlich an einem riesigen außenwirtschaftlichen Ungleichgewicht.
Leistungsbilanzdefizit von 580 Milliarden Dollar
Das Loch in der Leistungsbilanz steuert 2003 auf einen Rekordwert von 580 Milliarden Dollar. Im kommenden Jahr dürften die USA sogar für 600 Milliarden Dollar mehr Güter und Dienstleistungen hereinholen als sie selbst in der Lage sind zu leisten. Vor allem aus Asien werden die Amerikaner mit billigen Waren überschwemmt. Der Verlust von Millionen Arbeitsplätzen reduziert zudem die Chancen für eine Wiederwahl des amerikanischen Präsidenten George W. Bush.
Japan und China sollen Währungen aufwerten
Die US-Notenbank sowie Finanzminister John Snow drängen deshalb Japan und China, ihre Währungen gegenüber dem Dollar aufzuwerten. Über diesen Weg - so die Hoffnung - sollen auch die verteuerten US- Importe zu einer Verringerung des Handelsdefizits beitragen. Die unterschwellig als "Jobkiller" angeprangerten Asiaten denken allerdings nicht daran, ihren Währungen freien Lauf zu lassen. Die Bank von Japan stemmt sich mit massiven Interventionen an den Devisenmärkten gegen eine Yen-Aufwertung. Der nach Jahren tiefer Krise und Deflation aufkeimende Hoffnungsschimmer einer konjunkturellen Erholung wäre verflogen, wenn die Exporte nach Übersee an der Währungsfront gedrosselt würden.
China braucht Exporte
Auch China mit einer festen Anbindung an den Dollar will sich dem politischen Druck aus Washington nicht beugen. Im Reich der Mitte ist das Bankensystem derart angeschlagen, dass ein Stocken des Exportstroms kaum absehbare Folgen hätte.
Schwierige Zeiten auch für schwedische Krone
Für die internationalen Finanzinvestoren ist die Anlage in US-Papieren angesichts der komplexen Lage mit einem zusätzlichen Wechselkursrisiko behaftet. Falls sich die immensen Mittelzuflüsse vom Dollar abwenden und anderen Währungen zuwenden, könnte dies den Druck auf die amerikanische Devise zusätzlich verschärfen. Solange die großen asiatischen Akteure in Tokio und Peking an ihrer Politik festhalten, entfällt die Hauptlast eines schwachen Dollar auf Europa. Außer dem Euro sind dies das britische Pfund und die schwedische Krone, der nach dem "Nej" der Schweden zur Europäischen Währungsunion schwierige Zeiten drohen.