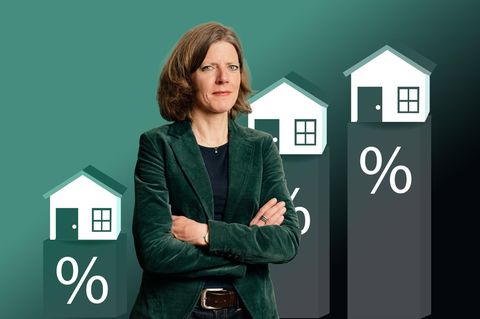Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und wer alles auf eine Karte setzt, gewinnt entweder alles oder verliert es. Im Spiel beherrschen wir Chance und Risiko gut - ob beim Skatkloppen oder im "Quiz Taxi". Einen "Grand ohne vier" kann man respektabel verlieren, 500 Euro wegen der verpatzten "Master-Frage" auch. Aber niemand verliert gern sein eigenes, sauer verdientes Geld. Dumm nur, dass es sich beim Geldanlegen genauso verhält wie beim Spielen: Je geringer das Risiko, desto niedriger die Gewinnchance. Geldanlegen hat im Gegensatz zum Zocken jedoch einen Vorteil: Sparer müssen nicht alles auf eine Karte setzen - und sollten es auch nicht. Die Auswahl ist groß, aber doch einfach zu sortieren: Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Geld selbst (siehe Tabelle). Dabei gilt: Die Mischung macht’s. Wer die fünf Vermögensarten geschickt kombiniert, mindert das Verlustrisiko - oder kann bei gleich bleibendem Risiko die Ertragschancen erhöhen.
Der entscheidende Kniff für Anleger: die Perspektive wechseln - statt auf einzelne lukrative Chancen zu schielen, müssen sie ihr gesamtes Vermögen in den Blick nehmen. Der Clou dabei: Egal, ob man bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen oder nur ein geringes - immer lässt sich durch die Kombination mehrerer Anlagen ein besseres Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erreichen als mit einem Wertpapier allein. Geht nicht? Doch. Der amerikanische Wirtschaftsforscher Harry M. Markowitz erhielt für diese Erkenntnis im Jahr 1990 sogar den Nobelpreis. Seine Berechnungen über das Zusammenspiel von Chancen und Risiken unterschiedlicher Geldanlagen machte der heute 80-Jährige schon in den 50er Jahren. Dabei ergab sich: Die Wertentwicklungen von Aktien und Anleihen verlaufen fast unabhängig voneinander, ja sogar einen Tick entgegengesetzt: Fallen die Aktien, bleiben die Anleihen stabil oder steigen sogar - und umgekehrt. Wer sein Erspartes also auf beide Vermögensarten verteilt, verringert die Gefahr von Verlusten. Wie stark die Entwicklung von Wertpapieren voneinander abhängt, messen Fachleute an der sogenannten Korrelation.
Preise von Rohstoffen weitgehend unabhängig von der Entwicklung großer Aktienmärkte
Ein Wert von "+1" bedeutet, dass sich zwei Anlagen im Gleichschritt bewegen, ein Wert von "-1" heißt, dass sich zwei Papiere vollkommen gegenläufig entwickeln, und ein Wert von "0" zeigt an, dass die Performances von zwei Vermögenswerten überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Für die vergangenen 20 Jahre errechnet sich zwischen Aktien aus Industrieländern und US-Staatsanleihen ein Wert von -0,03 - die beiden Anlagearten sind also für einen Markowitz-Mix bestens geeignet. Dagegen ergibt sich für Industrieländer-Aktien und weltweite Immobilienwerte eine Korrelation von 0,4. Noch stärker im Gleichschritt marschierten seit 1987 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern (Korrelation: 0,65). Was die Rechnerei lehrt: Wer deutsche Aktien im Depot hat und sein Risiko verringern will, sollte nicht unbedingt zu heimischen Immobilienwerten greifen und noch weniger zu Aktien aus China, Indien & Co. Weitgehend unabhängig von der Entwicklung großer Aktienmärkte bewegten sich hingegen die Preise von Rohstoffen (Korrelation: -0,02) und auch der Goldpreis (+0,02). So besehen, eignen sich Rohstoff-Investments also als Gegengewicht zu Aktienanlagen. Unabhängige Entwicklung von den Börsen versprechen zudem sogenannte Hedgefonds.
Doch es kommt nicht nur darauf an, die Vermögensarten klug zu mischen, sondern auch bei der Auswahl der einzelnen Werte die Risiken zu begrenzen. Auch dazu hat die Finanzwelt ein Hilfsmittel, eine Maßzahl: Sie heißt im Fachjargon "Volatilität". Sie gibt die jährliche Wertschwankung einer Geldanlage in Prozent an. Versierte Anlageberater in Banken und Sparkassen sollten diese Werte (wie auch Korrelationszahlen) parat haben. Beispiele: Für die vergangenen zehn Jahre beträgt die Volatilität von Dax-Aktienfonds im Schnitt rund 22 Prozent - jährlich rauf oder runter. Fast so hoch wie bei Schwellenländer-Aktienfonds, die im selben Zeitraum jährlich um rund 25 Prozent schwankten. Die durchschnittliche Volatilität von Euroland-Aktienfonds lag dagegen nur bei 17 Prozent. Deren Anleger konnten also deutlich ruhiger schlafen als Dax- oder Indien-Fans.
Der Preis der Sicherheit
Die Jahresrendite der "Schlafmittel" war allerdings zwei bis sieben Prozent niedriger als die der "Aufreger". Das ist der Preis der Sicherheit. Jeder Anleger muss selbst entscheiden, wie viel er ihm wert ist. Berechnungen à la Markowitz haben allerdings einen Nachteil. Sie funktionieren nur mit Daten aus der Vergangenheit. Wertentwicklung, Korrelation und Volatilität können sich ändern. Und die Zahlen bieten deshalb auch keine Garantie für künftige Dauerprofite bei minimalem Verlustrisiko. Aber: Das Wissen über Abhängigkeiten und Schwankungen unterschiedlicher Geldanlagen hilft, das Risiko von Bruchlandungen zu mindern - eben aus Erfahrung. Und wo bleibt da der gewiefte Spekulant, der mit dem "ganz heißen Tipp", mit dem legendären Riecher? Sicherheitshalber dort, wo keine ernsthaften Risiken für Ersparnisse lauern: in der Kneipe beim Skat oder im "Quiz Taxi".