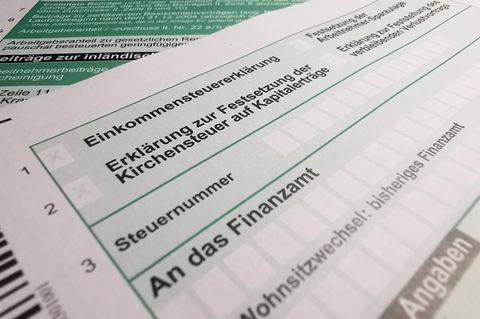Eine der kuriosesten Steuerarten in Deutschland ist die Kirchensteuer. Es gibt sie in dieser Form nur hierzulande, landesweit verankert allerdings schon seit 1919. Der Staat erlaubt seither Kirchen und Religionsgemeinschaften im Grundsatz den Einzug von Steuern – und zwar als direkten Abzug vom Einkommen ihrer Mitglieder. Zur Abwicklung dürfen die Kirchen die Finanzämter nutzen, gegen eine Gebühr von durchschnittlich drei Prozent des Kirchensteueraufkommens. Diesen Service nutzen im Wesentlichen die evangelischen EKD-Kirchen, die römisch-katholische Kirche sowie die jüdischen Gemeinden.
Kirchensteuer ist Ländersache
Man ahnt angesichts der beiden letztgenannten Umstände: Die Kirchensteuer ist nicht überall gleich. Ihre Regelung ist nämlich jenseits Artikel 140 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland Sache der Bundesländer. Dieser Umstand geht auf die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 zurück – und er wirkt bis heute nach, wie die folgenden Tabellen zeigen:
Wer in Baden-Württemberg lebt, kommt tendenziell am günstigsten weg: 2025 wird für ein Jahresbruttoeinkommen von 50.000 Euro dort Kirchensteuer in Höhe von 573,92 Euro vom Gehalt abgezogen. In allen anderen Bundesländern beträgt der Abzug 645,66 Euro, berechnet für Lohnsteuerklasse 1 ohne Kinder. Ein Kirchensteuer-Rechner findet sich online hier.
So weit, so verständlich. Aber: In Bayern erheben Gemeinden der evangelischen Kirche zusätzlich zu den acht Prozent Steuern ein sogenanntes Kirchgeld, derzeit zwischen fünf und 120 Euro jährlich. In Niedersachsen erhebt das katholische Bistum Hildesheim ein Ortskirchgeld in vergleichbarer Höhe. Und in Hamburg und Berlin ziehen kleinere Kirchen wie etwa Mennoniten- und Hugenotten-Gemeinden die Steuern ihrer Mitglieder eigenständig ein.
Doch damit nicht genug föderaler und lokaler Eigenheiten. Die Abzugsbeträge verraten nicht, wie hoch die tatsächliche Abgabe an die Kirche sind. Denn zum einen haben die Bundesländer sogenannte Kappungen eingeführt, in unterschiedlicher Höhe (siehe Tabellen). Und zum anderen fördert der Staat die Kirchenmitgliedschaft, indem er die gezahlten Kirchensteuern und auch Kirchgelder im Einkommensteuerausgleich voll als Sonderausgaben anerkennt. Der Reihe nach:
So wirken Kirchensteuer-Kappung und Sonderausgaben-Abzug
In Berlin etwa beträgt die Kappung der Kirchensteuer im Jahr 2024 drei Prozent des Jahresbruttoeinkommens. In der Hauptstadt berechnen die Finanzämter automatisch daraus die maximale Kirchensteuer. Für ein Jahresbrutto von 50.000 Euro also maximal 1500 Euro, statt des Neun-Prozent-Satzes von 4500 Euro. Hinzu kommt – je nach persönlichen Steuerumständen – der Sonderausgaben-Abzug. Die Wirkung des Kappungssatzes entfaltet sich erst beim zu versteuernden Einkommen. So erklärt sich im obigen Fallbeispiel mit Steuerklasse 1 ohne Kinder der Betrag von 645,66 Euro. Die Kappung verhindert insbesondere bei hohen Einkommen eine nach oben offene Abgabe an die Kirchen.
Aber selbst beim Kappungssatz ist nicht überall alles gleich: In Bayern etwa gibt es keine Kappung. In anderen Ländern ist sie unterschiedlich hoch: In Baden-Württemberg war sie zuletzt mit 2,75 Prozent am günstigsten – aber nur für Mitglieder der evangelischen Kirchen in Württemberg. In Baden wurde erst bei 3,5 Prozent gekappt, wie im ganzen Bundesland für Katholiken. In NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland waren die Kappung mit vier Prozent am höchsten – allerdings nur für die Mitglieder der katholischen Kirche.
Mehr noch: Anders als etwa in Berlin rechnen nicht alle Finanzämter der Bundesländer die dort geltenden Kappungen automatisch ein. Steuerzahler müssen dazu einen Antrag stellen (siehe Tabellen).
Kirchensteuer – eine Art gemeinnützige Spende
Die Kappungssätze können die Bundesländer durchaus ändern. Denn es ist eine staatliche Unterstützung. So lag das Kirchensteueraufkommen im Jahr 2007, einem schwachen Einnahmejahr, insgesamt bei rund neun Milliarden Euro, wovon knapp 40 Prozent aus allgemeinen Steuermitteln mittels Kappung und Sonderausgaben-Abzug finanziert wurden. Der Staat begründet diese Subvention damit, dass die Angebote der Kirchen – Gemeindeaktivitäten, Schulen, Krankenhäuser, Sozialdienste – per se allen Menschen zugutekommen. Die Kirchensteuer wird vom Fiskus als eine Art gemeinnützige Spende angesehen. Zuletzt lag das Gesamtaufkommen bei rund 13 Milliarden Euro.
Aufgrund der prozentualen Koppelung an die Einkommen helfen den Kirchen in Sachen Steuern – ihrer mit Abstand wichtigsten Finanzierungsquelle – steigende Löhne und steigende Kapitalerträge ihrer Mitglieder. Denn auch auf Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen von Investmentfonds ist Kirchensteuer zu entrichten. Von diesen Kapitalerträgen oberhalb der Freigrenze von 1000 Euro pro Jahr werden je nach Wohnort acht beziehungsweise neun Prozent abgezogen – im Grundsatz ohne Kappung.
Aber es geht noch mehr: Wer Mitglied der katholischen Kirche im Bistum Speyer ist und dort Grundbesitz hat, zahlt darauf Ortskirchensteuer: zehn Prozent auf den Grundsteuermessbetrag. Macht laut Bistum im Schnitt rund sechs Euro – pro Jahr.
Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis: Erst die persönliche Steuererklärung mit der beigefügten Anlage KAP für Kapitalerträge und jener für den Sonderausgaben-Abzug verrät Kirchenmitgliedern, wie hoch ihr Obolus an die Gemeinde wirklich war. Unter finanziellen Druck bringen die Kirchen neben der Inflation vor allem Austritte von Mitgliedern – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen.