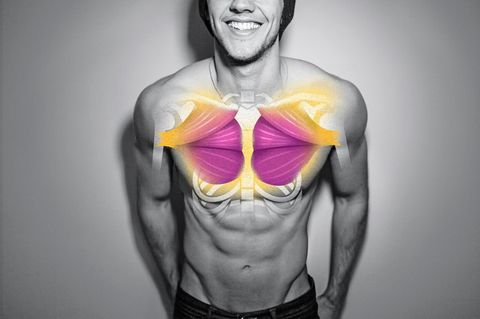Kurz vor Weihnachten hustet und schnieft es in allen Ecken. In vielen Arztpraxen ist das Wartezimmer voll. Laut dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) leiden derzeit 7,9 Millionen Menschen in Deutschland unter einem Atemwegsinfekt. Doch wie viele Corona-Infektionen sind darunter?
In den Pandemiejahren wurde fleißig zu Hause, in den Arztpraxen oder Testcentern getestet, um zu wissen, ob Halsschmerzen, laufende Nase und Fieber an einer Erkältung liegen oder man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der positive Schnelltest musste noch mit einem PCR-Test bestätigt werden und die Hausarztpraxis hat den Fall gemeldet. So hatte das RKI einen guten Überblick über die Zahl der Corona-Infizierten.
Der Blick in das Corona-Pandemieradar verrät, dass die aktuelle 7-Tage-Inzidenz der gemeldeten Fälle bei 38 liegt (Stand: 15.12.23). Zur Erinnerung: Die 7-Tage-Inzidenz gibt Aufschluss darüber, wie viele Menschen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner:innen an Covid-19 erkrankt sind. In den Hochzeiten der Omikronwelle im Frühjahr 2022 lag die 7-Tage-Inzdenz bei fast 2000. Die nackten Zahlen lesen sich so, als ob sich fast niemand derzeit in Deutschland mit Covid-19 ansteckte. Doch ganz so einfach ist es nicht.
Corona-Tests werden längst nicht mehr flächendeckend gemacht
Die Situation ist heute eine andere. Einen Corona-Test können wir freiwillig zu Hause machen. Systematisch getestet wird nur noch in Krankenhäusern bei symptomatischen Patienten:innen. Heißt also: Die 7-Tage-Inzidenz von 2022 und die von heute lässt sich so nicht vergleichen. Um die Lage der Covid-19-Infektionen besser einschätzen zu können, bedient sich das RKI heute weiterer Wege. Zum einen nutzt das RKI, Angaben der Grippe-Web-Teilnehmenden, um die Corona-Lage einschätzen zu können. So liegt die geschätzte 7-Tage-Inzidenz laut aktuellem Wochenbericht bei 2500 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner:innen. Für die Schätzungen nutzt das RKI auch die Erkenntnisse der SentiSurv-Studie der Universitätsmedizin Mainz. Hierfür testen sich 10.000 repräsentativ ausgewählte Erwachsene aus Rheinland-Pfalz einmal wöchentlich. SentiSurv kommt auf eine 7-Tage-Inzidenz von 3896 in Rheinland-Pfalz in der Woche bis zum 13. Dezember.
Zum anderen wird die Viruslast im Abwasser gemessen. Die Viruslast mit durchschnittlich fast einer Million Genkopien in einem Liter Wasser hat seinen Höchststand seit Messbeginn im Juni 2022 erreicht. Die neusten Daten reichen im Corona-Pandemieradar bis zum 29. November (Stand 12.12.23) . Das Abwassermonitoring ist ein wichtiges Mittel, um Trends der Corona-Lage zu erkennen. Denn: Wie beschrieben, können sich Wissenschaftler:innen nicht mehr so auf die 7-Tage-Inzidenz verlassen wie zu Zeiten der Testpflicht. In den Daten des Abwassermonitorings lässt sich beobachten, dass die Viruslast im Abwasser seit Ende Juni 2023 ansteigt. Es ist also ein Trend erkennbar.
Abwassermonitoring: Trends sind erkennbar
Doch woher stammen die Daten im Abwassermonitoring überhaupt? Das RKI erhält aktuell die Daten aus 82 Kläranlagen in Deutschland. Diese sind allerdings nicht repräsentativ ausgewählt. Ist ein Mensch mit Sars-CoV-2 infiziert, scheidet er oder sie über den Stuhl, Urin oder Speichel den Krankheitserreger aus. Durch die Entnahme von Proben im Abwasser der Kläranlagen können Wissenschaftler:innen also auswerten, wie hoch die Viruslast je Liter Wasser ist. Dafür wird die Probe im Labor aufbereitet und das Coronavirus mittels PCR-Test nachgewiesen. Die Überwachung des Coronavirus im Wasser ist eine ergänzende Maßnahme, um die Corona-Lage besser einschätzen zu können. Das Abwassermonitoring liefert Informationen zur Viruslast und zur Infektionsdynamik.
Ablesen lässt sich daraus allerdings nicht, wie viele Menschen genau an Covid-19 erkrankt sind. Infizierte Menschen scheiden mal mehr und mal weniger Viren aus – je nachdem mit welcher Variante sie sich infiziert haben oder wie lange sie die Infektion schon haben. Auch lässt sich nicht die Schwere der Infektion oder die Belastung des Gesundheitssystems ablesen. Bedeutet also: Die Daten aus dem Abwassermonitoring sind lediglich eine Ergänzung. Neben Sars-CoV-2 könnten künftig auch weitere Krankheiten in so einem Monitoring besser überwacht werden.