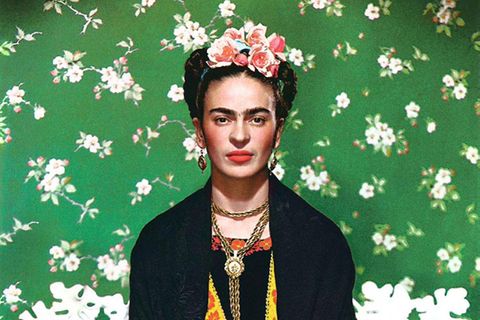Zu den besonderen Perfidien, die Mutter Natur in unseren Körper eingebaut hat, gehört die Schwäche seiner Gelenke und Sehnen. Neben akuten Verletzungen und chronischer Abnutzung sind es diverse Fehl- und Dauerbelastungsschäden, die Millionen Deutsche quälen - etwa Kalkschulter, Fersensporn und Tennisarm. Der Hannoveraner Orthopäde Gerhard Hensler, Sport- und zudem vormals Mannschaftsarzt der belasteten Balltreter des örtlichen Bundesligisten, schätzt, dass rund ein Viertel seiner Patienten wegen derartiger Krankheiten in die Praxis kommt. Beispiel Schulter: Die "Rotatorenmanschette" ihres Gelenks hat vier Sehnen, in denen sich durch dauernde Belastung Kalkherde bilden, die langsam wachsen; zunächst, ohne Beschwerden zu verursachen. Haben die Steinchen eine kritische Masse erreicht, bewirken sie mechanische Behinderungen. Schlimmer noch: Sie verursachen oft Entzündungen und Schwellungen des umliegenden Gewebes. Besonders nachts plagen sich die Befallenen, Schmerzen zermürben sie und machen sie arbeitsunfähig - ein Martyrium.
Was dem Märtyrer sein Essigschwamm, das ist dem Schulter-Verkalkten die konservative Therapie mit Kortison, Anti-Rheumatika wie Diclofenac ("Voltaren") und Einreibungen: Die Medikamente lindern Schmerzen und dämpfen die Entzündung - packen das Leiden aber nicht an der Wurzel. Deshalb setzt Hensler oft darauf, die Kalkklümpchen mit einem Stoßwellengerät zu zerstören, falls die hergebrachten Methoden keine dauerhafte Besserung bringen. Dazu wird eine Maschine benutzt, die dem bekannten Nierenstein-Zertrümmerer ("Lithotripter") gleicht: Sie erzeugt Serien starker, scharf gebündelter Schallwellen, die sie wie ein Specht in das zu behandelnde Gewebe tackert, allerdings ohne Haut und Muskeln zu beschädigen. Treffen die Wellen auf den Widerstand fester Strukturen, überträgt sich ihre Energie darauf. Dadurch wird der eingelagerte Kalk zerrüttelt und zerbröselt. Feinst zermahlen, kann er vom umliegenden Gewebe absorbiert werden. Der volle wissenschaftliche Name der ratternden Prozedur lautet "Extrakorporale Stoßwellentherapie" (ESWT). Ihre Anwender legen großen Wert darauf, dass sie nicht mit der "radialen Stoßwellentherapie" verwechselt werden dürfe. Letztere Methode kann weder die Kräfte der ESWT entfalten (deren Stoßwellen vermögen mehrere hundert Bar Druck zu erzeugen), noch kann sie exakt fokussiert werden.
Der Berliner Chirurg und Sportmediziner Richard Thiele, Präsident der "Deutschen und Internationalen Gesellschaft für Extrakorporale Stoßwellentherapie" (DIGEST) ist ein entschiedener Fürsprecher des Verfahrens. Neben der mechanischen Zerkleinerung der kalkigen Fremdkörper habe es noch weitere nutzbringende Wirkungen: "Es hat sich gezeigt, dass die Einwirkung der Wellen Heilungsprozesse im Knochengewebe auslösen kann, die etwa das Wiederanwachsen sich ablösender Knochenfragmente fördern - eine Art natürlicher Bioengineering-Prozess", sagt Thiele.
Üblich ist bislang neben der Kalkschulter-Therapie die Behandlung des Fersensporns und des berüchtigten Tennisarms. Bei Verdachtsfällen bedarf es jedoch zuvor einer eng gefassten Diagnose. Denn bei Allerweltsformen von Schulterschmerz, etwa bei Verspannungen, hilft die ESWT nicht. Und sie ist nicht billig. Bis zum Eintreten des Behandlungserfolges sind oft mehrere Betackerungen durch den Magnet-specht nötig, die, so Thiele, mit je 216 bis 330 Euro zu Buche schlagen.
Das ökonomische Argument hat enormes Gewicht: Nachdem die ESWT vor gut zehn Jahren auf den Medizinmarkt kam, erlebte sie einen irrwitzigen Boom. Frohgemute Orthopäden schossen auf so gut wie alles, was sich nicht mehr bewegte. So provozierten sie, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der ESWT seit 1998 nicht mehr tragen. Ihre Forderung: Erst sollen die Anwender auf hohem wissenschaftlichen Niveau belegen, dass sie funktioniert. Inzwischen sind viele Studien (mit unterschiedlichen Ergebnissen) erstellt, weitere folgen. Es wird heftig gestritten - wie immer, wenn eine Umverteilung saftiger Stücke aus dem Kosten-Kuchen droht.
Allerdings gibt es ein gewichtiges Argument für die ESWT: Wenn die üblichen Verfahren ausgeschöpft sind, gibt es außer ESWT nur noch Voodoo und die Möglichkeit, zu operieren. Doch häufig angewendete OP-Verfahren (für die die Kassen aufkommen müssen) sind oft nicht besser erforscht als die ESWT.