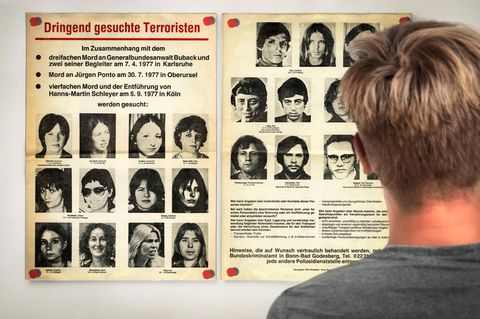Der Applaus ebbt einfach nicht ab. Fasziniert beklatscht das Publikum die Filmheldinnen des Abends: Mina, Klara und Tanutscha, drei sechzehnjährige Schülerinnen aus Berlin-Kreuzberg. Die letzte Berlinale-Vorführung des Dokumentarfilms "Prinzessinnenbad", der die Mädchen beim Erwachsenwerden im berüchtigten "Multikultikiez" begleitet, war längst kein Geheimtipp mehr. Die Geschichte der drei vorlauten wie liebenswerten Freundinnen, die zwischen türkischen Jungs, alternativen Müttern, abwesenden Vätern, Schulfrust und Drogenerfahrungen ihren Weg durch die Pubertät suchen, hat von Anfang an die Zuschauer begeistert und bekam am Ende der Berlinale den Nachwuchspreis "Dialogue en perspective", mit dem jedes Jahr ein Film aus der Sektion "Perspektive Deutsche Kino" ausgezeichnet wird.
Als die drei Mädchen nach der Vorstellung auf der Bühne vor der Kinoleinwand im Rampenlicht stehen, verlegen lächelnd, händchenhaltend, wissen sie offensichtlich nicht so genau, wofür sie so viel Applaus bekommen. Sie haben ja nichts Außergewöhnliches gemacht. Nicht geschauspielert oder so, wie Mina später sagt, sondern sich "nur" bei ihrem Leben beobachten lassen. Doch das zieht rein. Der Film eröffnet mit einer Szene im Kreuzberger "Prinzenbad", in dem die Mädchen ihren Sommer verbringen und das der Dokumentation seinen Namen gegeben hat. Geschminkt, frisiert und stets mit einer Zigarette in der Lipgloss-Schnute sind die damals vierzehnjährigen Freundinnen nie um einen flotten Spruch verlegen: "Rasierst Du dich auch unter den Armen?", fragen sie, während sie den nackten Oberkörper eines jungen Türken befühlen. Und falls ihnen einer blöd kommt, teilen sie schlagfertig aus: "Lass dir doch erst einmal einen Penis wachsen!"
Rauher Ton herrscht vor
Hier herrscht ein anderer Ton, als in den Freibädern westdeutscher Kleinstädte, in denen wohl die Mehrheit des Kinopublikums seine Jugenderfahrungen gesammelt hat. Das fasziniert. Es ist das echte Leben, in einem Mulitkulti-Problembezirk mit hoher Arbeitslosigkeits- und Schulabbrecherquote, unsicheren Zukunftsperspektiven und einer komplexen Mischung aus konservativer muslimischer Einschränkung und alternativer Berliner Freiheit. Hier sind die drei Protagonistinnen zu Hause, hier verläuft ihr Weg durchs Erwachsenwerden, den sie für das Publikum sehr unterhaltsam ausloten: forsch und unsicher, rauh und charmant, stark und verletzlich.
Leben ohne Väter im "Multikulti"-Problembezirk
Mina, Klara und Tanutscha sind Deutsche, doch "Multikulti" ist für sie kein verklärter Gesellschaftstraum, sondern fordernde Lebensrealität. Minas Vater ist Italiener, Tanutschas Vater Iraner und Klaras Vater lebt in Panama - alle drei haben ihre Familien verlassen. Die Mädchen wachsen bei ihren alternativen Berliner Müttern auf, die inmitten der größten türkischen Gemeinde außerhalb der Türkei versuchen, ihren Töchtern möglichst viel Freiheit zu lassen. Das erleichtert den Mädchen nicht unbedingt die jugendliche Orientierungssuche. "Ich hätte mich schon gefreut, wenn du mal öfters etwas gesagt hättest", sagt Klara im Film zu ihrer Mutter.
Drogenerfahrungen, Jungsenttäuschungen, Schulschwierigkeiten, Straßenleben - das teilen sie in erster Linie mit ihren Freundinnen. Zart und unerfahren und gleichzeitig abgehärtet und herausfordernd ziehen sie gemeinsam durch ihre Pubertät - und ihren Kreuzberger Kiez, auf den sie so stolz sind. Wenn sie am Telefon mit Jungs aus anderen Bezirken flirten und diese nicht sofort begreifen, dass sie mit dem coolsten Bezirk Berlins verbunden sind, gibt es was auf die Ohren: "Ich komm aus Kreuzberg, du Muschi!", klärt Tanutscha dann erst mal ungehalten die Lage.
Hier fühlen sich die Mädchen am wohlsten. Die zahlreichen Journalisten von Zeitungen, Radio und Fernsehen, die sich nach dem Film für ihre Geschichte interessieren, bestellen sie am liebsten mittenrein in ihre Welt. "Hier sind viele schöne Clubs, nette Cafés, und es ist einfach total gemixt, das ist natürlich auch sehr schön", erklärt Mina in einem freundlichen und reflektierten Ton. "Kultimulti!" ruft Tanutscha mit ihrer markanten rauhen Stimme dazwischen und schickt ihr sympathisch heiseres Lachen hinterher. Die unverblümte, kecke Art, mit der sie auch im Kino die Zuschauer bei Laune gehalten hat, war offensichtlich nicht nur Filmpose.
Tausendmal drauf angesprochen
Als die Leinwandheldinnen zum Interview in der "Roten Harfe" sitzen, einem ihrer Lieblingscafés mitten im Kiezgeschehen, ist auf den ersten Blick kein Unterschied zum Filmleben zu bemerken. Kapuzenpullover, Jeans, weiße Halstücher, Nasenringe, Zahnfleischpiercing, aufgeschlossene Mädchengesichter mit kindlich weichen Lippen - alles genauso wie im Film. Nur, dass die drei jetzt davon erzählen, wie komisch es ist, plötzlich mit dem eigenen Leben in der Öffentlichkeit zu stehen. "Ich dachte nicht, dass der Film so viel Aufmerksamkeit erregt", sagt Klara. "Ich dachte, er läuft irgendwann mal nachts auf arte." - Und jetzt werden sie plötzlich auf der Straße angesprochen: "Der Mann am Kiosk hat gesagt, er hat in der Zeitung alles über mich gelesen!" "Meine Lehrerin will, dass wir mit der ganzen Klasse in den Film gehen. - Kommt nicht in Frage!" "Ich bin auch schon tausendmal darauf angesprochen worden, das stresst mich voll!"
Vor der Filmpremiere hatten sie ganz schön Angst. "Wir haben den Film kurz vorher zum ersten Mal gesehen, und ich dachte nur: ‘Scheiße! Der kann nicht in die Kinos kommen!' Ich war ehrlich gesagt total geschockt!" Mina seufzt schicksalsergeben. "Unser Leben kommt ein bißchen krasser rüber, als es in Wirklichkeit ist", findet Klara. "Aber wir haben es ja nicht geschauspielert!" erinnert Tanutscha. "Es ist also auch ein Stück 'wir'".
Klaras Drogenbeichte oder ihre Jungsbilanz
So einiges hätten sie vor den vielen Zuschauern doch lieber geheim gehalten. Zum Beispiel Tanutschas zerrüttetes Verhältnis zu ihrem Vater. Oder Klaras Drogenbeichte, oder ihre Jungsbilanz: 31! "Das stimmt so natürlich nicht! Da war in Wirklichkeit kaum etwas, mal küssen, mal flirten. Das kam im Film falsch rüber" erklärt Klara. "Ich habe jetzt erst meine erste richtige Beziehung. Wir sind seit elf Monaten zusammen." Der Anfang dieser Beziehung wurde auch im Film erzählt. Klaras Traummann ist Türke, natürlich, denn auf deutsche Typen steht die zierliche Blondine überhaupt nicht. Das muss sie im Film immer mal wieder loswerden. Sie gibt zu, dass sie es mag, wenn Männer ihr Vorschriften machen - und sie dann trotzdem ihre Freiheiten auslotet. Klaras erste richtige Liebe jedenfalls, ein sympathischer Dönerverkäufer Mitte zwanzig, war nach dem Film nicht begeistert darüber, dass seine Freundin als männerverschlingende Pornostaranwärterin gesehen werden könnte. "Er war schon geschockt", gibt Klara leise zu. " Aber ich hoffe, er beruhigt sich jetzt wieder."
Familien sind stolz auf ihre selbstbewussten Mädchen
Bereut haben Klara und ihre Freundinnen den Film aber nicht. "Es war eine tolle Erfahrung, und es ist auch ein schönes Andenken. Später können wir unseren Kindern einmal zeigen, wie wir früher waren." Alle nicken. Ihre Familien habe die Dokumentation auch nicht geschockt, sagen sie. "Die wissen ja, wie wir sind!" Die seien eher stolz gewesen auf ihre selbstbewussten Mädchen.
Trotz öffentlich preisgegebener Intimitäten haben die drei letztendlich doch Gefallen gefunden am Filmemachen: "Ich fände es lustig, wenn wir in ein paar Jahren eine Fortsetzung machen würden" sagt Mina. "Wo man sieht, wie wir uns verändert haben, und wie jeder dann seinen Job macht." "Aber dann kennt keiner mehr unseren jetzigen Film", gibt Tanutscha zu bedenken. Mina sieht es pragmatisch: "Da muss man dann halt vorher noch mal ein bisschen drüber schreiben!" Schließlich haben sie Gefallen gefunden an dem Bühnenapplaus und den Interviews. Aber sie wissen auch, dass wenn das öffentliche Interesse abflaut, eins bleibt: ihr Leben. Mit den noch ausstehenden Schulabschlüssen, den zarten Liebesbeziehungen, den anstehenden Berufsentscheidungen. Dieses, ihr Leben geht dann einfach weiter, das wissen sie, - auch ohne Kamera.
"Prinzessinnenbad", D 2007, 92 Min, Regie: Bettina Blümner - kommt voraussichtlich ab Mai in den Kinos