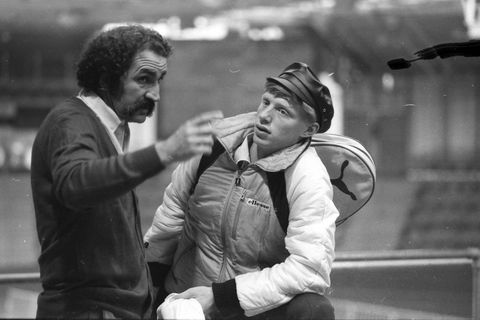Tennisfans brauchen dieser Tage starke Nerven. Nicht nur, was die sportlichen Dramen in Wimbledon anbelangt (Zverevs dramatisches Aus, Sinners Schwindelanfälle, Djokovics Beef mit den Fans). Nein: Wer aktuell so viele TV-Matches sehen möchte, wie es die Erwerbstätigkeit erlaubt, der muss versuchen, stundenlanges Mansplaining der TV-Kommentatoren beim übertragenden Sender Amazon Prime zu verkraften.
Ja, Kommentatoren, Maskulinum. Voraussetzung für einen Job als Power-Laberer im Team rund um die Studio-Moderatoren Katharina Kleinfeldt und Alexander Schlüter scheint die Bereitschaft zu sein, alles, aber auch wirklich alles, besser zu wissen als die Spieler auf dem Platz, und dies in jeder noch so winzigen Situation deutlich zu äußern. Ein Talent, das in dieser Intensität – die Lebenserfahrung lehrt es – eindeutig Männern vorbehalten ist. "Den hätte ich so nicht geschlagen", heißt es ständig, und am Fernsehbildschirm möchte man nur ausrufen: "Natürlich nicht, weil du nicht auf dem Wimbledon-Centre-Court spielst!"
Es wird einfach immer weitergeredet
Ruhe kehrt im TV nie ein. Nicht bei Aufschlägen – was eigentlich die Tennis-Etikette gebietet. Auch nicht in Schlüsselmomenten, die im Tennis oft so spannend sind, weil man live dabei zusehen kann, wie sich ein Match innerhalb von Minuten, manchmal Sekunden drehen kann. Es wird einfach immer weitergeredet, auch dann, wenn es nichts zu berichten gibt, etwa in der Partie Zverev vs. Fritz: "Er entscheidet sich für Rückschlag, das ist interessant, ein Indiz für… ach nee, doch nicht, er schlägt doch auf."
Und sollte für eine Millisekunde der Gesprächsstoff ausgehen, kann man ja immer noch Ausflüge in längst vergangene Tennis-Zeiten unternehmen. So kramt TV-Experte Michael Stich, der Wimbledon 1991 gegen Boris Becker gewann, in einem fort Uralt-Anekdoten vor, die fürs aktuelle Geschehen wenig relevant sind. Wen interessiert schon, mit wem er in den 90er-Jahren seinen "Rückhand Longline Slice" trainiert hat? Ansonsten scheint er sich als Philosoph der Tenniswelt etablieren zu wollen, wenn er mit Kalendersprüchen um sich wirft. "Spieler kommen und gehen, das Spiel bleibt" oder "Du willst nicht nicht verlieren, sondern gewinnen."
Selbst für passionierte Tennisfans ist es wahnsinnig anstrengend, wenn sich die TV-Kommentierung so anfühlt, als sei man versehentlich in die After-Turnier-Besprechung der Herren-50-Mannschaft des lokalen Tennisvereins gestolpert. Denn all das, was Wimbledon zu einem der legendärsten Sportereignisse der Welt macht, das Drumherum, das Flair, die prominenten Gäste im Publikum, bleibt während der endlosen "Hättest du diesen Ball so gespielt?"-Fachsimpelei völlig unerwähnt.
Warum sitzt Prinzessin Beatrice in der Royal Box?
Aber klar: Dafür müsste man natürlich im Vorfeld recherchieren, nachlesen, ein bisschen acht geben, welche Beobachtungen die Zuschauer zu Hause abseits der Kommentierung des Offensichtlichen interessieren könnten: Wer sind die verrückten Ladys in der Box von Taylor Fritz? Was bedeutet die Geigen-Pantomime von Djokovic nach dem Match gegen Holger Rune? Und warum sitzt in diesem Jahr Prinzessin Beatrice statt Prinzessin Kate in der Royal Box? All das müssen geneigte Tennis-Zuschauer selbst recherchieren.
Vielleicht sollte man mal über eine Aufhebung der immer noch üblichen Geschlechtertrennung bei der Kommentierung nachdenken (das ist ja nicht mal mehr beim Fußball so!). Das weibliche Wimbledon-Team, darunter die angenehme Barbara Rittner, die einfühlsame Daniela Hantuchová und die eloquente Andrea Petković, darf nur die Damenspiele kommentieren. Dabei wirken die Expertinnen stets gut vorbereitet, baden nicht fortwährend im Glanz der Vergangenheit und haben alle einen Sinn dafür, den Moment wirken zu lassen. Das hätte man gern bei jedem Match. Nur so eine Idee, ganz frech als Aufschlag von unten ins Spiel gebracht.