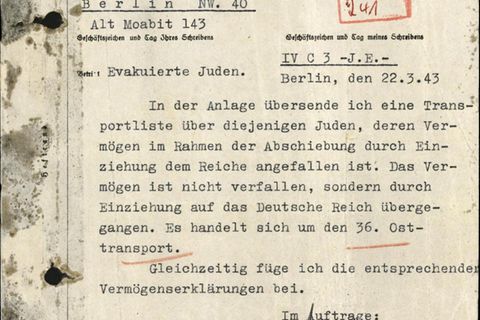Anfangs häufig noch ohne behördliche Genehmigung verlegt, gehören die Stolpersteine mittlerweile in vielen Kommunen zum Stadtbild - und das nicht nur in Deutschland. In 30 anderen europäischen Ländern haben lokale Initiativen diese Form des Gedenkens aufgegriffen.
Video
Das Unrecht nicht vergessen - bald sind es 100.000 Stolpersteine, die an NS-Opfer erinnern

STORY: "Ja, also hier haben wir eine Mutter, die als asozial stigmatisiert wurde. Das Kind wurde in ein Kinderheim gegeben. Beide sind ermordet worden. Die Mutter in Auschwitz, das Kind in Maly Trostinec." Zwei Schicksale, zwei Opfer der Nazi-Herrschaft. Kleine Gedenktafeln im Pflaster des Gehwegs vor dem Haus in Köln, in dem sie einst wohnten, sollen an Mutter und Kind erinnern. Seit über 30 Jahren fügt der Künstler Gunter Demnig für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung solche Stolpersteine in das Pflaster deutscher Gehwege. Bald werden es 100.000 sein. "Stolpersteine sind Erinnerungssteine, 33-45 Opfer der Nazis, für alle Opfergruppen. In der Regel liegen die Steine vor ihren letzten freiwillig gewählten Wohnsitzen." Auf eine Messingtafel werden in Demnigs Werkstatt im Vogelsberg in Hessen Name und Geburtsdatum geprägt, dazu Angaben zu den Todesumständen des Menschen - Buchstabe für Buchstabe in Handarbeit. Und immer wieder aufs Neue: "Hier wohnte..." , "Hier lernte...", "Hier praktizierte..." "Also ich werde immer wieder gefragt, warum lasst ihr das nicht fräsen in der Fabrik? Und ich sage dann: Auschwitz war fabrikmäßiges Morden. Deswegen ist es für mich wichtig, dass diese Bleche, die Schrift per Hand eingeschlagen wird." Im jüdischen Talmud heiße es, ein Mensch sei erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist, sagt der Künstler. Dieser Satz sei zentral für seine Arbeit. Angefangen hat das Projekt, das mittlerweile zu seinem Lebenswerk geworden ist, vor über drei Jahrzehnten in Köln. "Also der erste Prototyp war am 16. Dezember 92 vor dem Kölner Rathaus. Da ging es nicht um den Namen "Hier wohnte", sondern es war der sogenannte Himmler-Befehl, die Zigeuner, die Roma und Sinti nach Auschwitz zu bringen. Das war ihr Todesurteil. Dieser Stein ist etwas illegal verlegt worden, ist inzwischen Ziel der Stadtrundfahrten." Anfangs häufig noch ohne behördliche Genehmigung verlegt, gehören die Stolpersteine mittlerweile in vielen Kommunen zum Stadtbild - und das nicht nur in Deutschland. In 30 anderen europäischen Ländern haben lokale Initiativen diese Form des Gedenkens aufgegriffen. Noch in diesem Jahr könnten es 100.000 Stolpersteine werden - das größte dezentrale Mahnmal der Welt. "Und ich kann sagen, ich war auch so naiv zu glauben, es müsste irgendwann weniger werden, weil ja in einigen Orten wirklich, kann man sagen, speziell für die jüdischen Opfer liegen alle Steine, es kommen immer noch welche dazu, gerade für Behindertenmorde." Längst legt der Künstler nicht mehr all die Stolpersteine selbst, die von Schulklassen, Vereinen, Stadthistorikern in Auftrag gegeben werden. Doch ans Aufhören denkt der 75-Jährige nicht: "Weil gerade die jungen Leute wollen wirklich wissen, wie konnte das alles im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren. Und dann das Resümee: So etwas darf nie wieder passieren." Die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Hetze und Verfolgung - mit Hilfe der Stolpersteine soll sie nie verblassen.