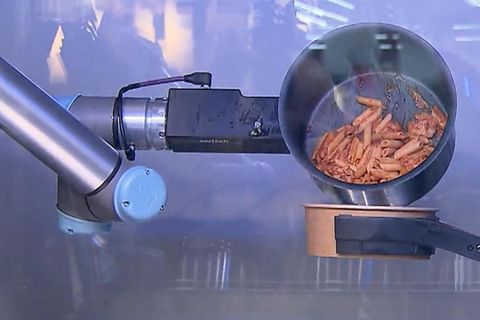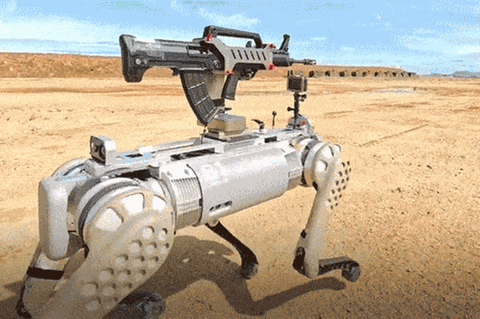Das Vorbild für Lauron IV ist tatsächlich eine Stabheuschrecke. Der Roboter - entwickelt von Forschern aus Karlsruhe - bewegt sich auf seinen sechs metallenen Beinen voran und ist als Rettungsgerät konzipiert. Er war zusammen mit etwa 25 anderen Robotern unlängst auf einer Fachtagung in Ilmenau zu sehen, auf der sich rund 140 Forscher aus aller Welt über die neuesten Erkenntnisse beim Bau von bionischen Robotern austauschten.
In schwierigem Gelände sind Beine unverzichtbar
Zu den Erkenntnissen gehört auch, dass gerade für die Bewegung von Robotern in schwierigem Gelände Beine nahezu unverzichtbar sind, berichtete etwa der US-Amerikaner Roy Ritzmann von der Case Western Reserve University. Die Suche nach Verschütteten in den Trümmern des World Trade Centers habe dies bewiesen - Roboter auf Raupen stießen in den Schuttmassen schnell an ihre Grenzen.
Doch wie Laufen funktioniert, davon haben die Forscher noch sehr unklare Vorstellungen. Von dem Glauben, man könne einen Roboter durch maximale Kontrolle der einzelnen Komponenten zum Laufen bringen, habe man sich inzwischen verabschieden müssen, sagte der Jenaer Zoologe Martin S. Fischer. Und auch Auke Jan Iispeert aus Lausanne weiß, dass man biologische Funktionen nicht programmieren kann. Es sei daher wichtig, die natürlichen Funktionsprinzipien zu erkennen und ingenieurtechnisch umzusetzen.
Kognitive Fähigkeiten sind nötig
Das erfordert eine immer engere interdisziplinäre Zusammenarbeit, sagte Rudolf Bannasch von der TU Berlin. "Die Schnittstellen zwischen der Biologie und der Technik werden immer enger." Neue Verfahren und Werkstoffe bis hin zu Biomaterialien eröffneten dabei immer bessere Möglichkeiten der Adaption. Doch gerade die am engsten benachbarten Disziplinen kommunizierten am wenigsten miteinander, bemängelte Bannasch.
Robotern das Laufen beizubringen, birgt noch ein weiteres Problem. Um sich autonom bewegen zu können, bedürfe es auch kognitiver Fähigkeiten, erläuterte Oskar von Stryk von der Universität Darmstadt. Das betreffe insbesondere das Sehen. Die bisher einsetzbaren Systeme ermöglichten im Prinzip nur bei guter Ausleuchtung in einer bestimmten Szenerie, die Dinge zu erkennen, die man auch erwarte. Fast völlig unklar sei auch, wie visuelle Informationen in zielgerichtete Bewegungen umgesetzt werden können. Fischer beschrieb das Problem aus Sicht des Biologen: "Kein Mensch überlegt, wie er läuft." Und Bannasch, der nach eigenem Bekunden "alles bis ins Letzte seziert hat, was ihm unter die Finger gekommen ist", ergänzte: "Erst wenn man anfängt einen Roboter zusammenzusetzen, versteht man, was alles dazu gehört."
Uwe Frost/DDP