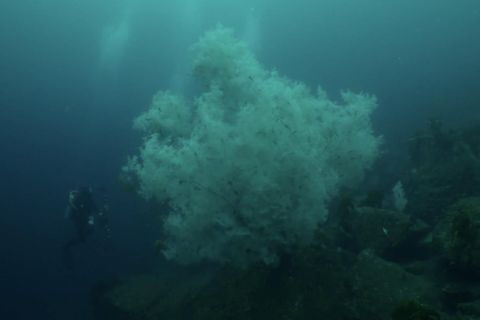Forscher haben erstmals in Deutschland Wein aus gentechnisch veränderten Reben produziert, die im Freiland gewachsen waren. Im unterfränkischen Veitshöchheim wurden zu Forschungszwecken 50 Flaschen abgefüllt, im rheinland-pfälzischen Siebeldingen vier Liter. Der Wein war im Sommer 1999 angepflanzt worden. Er werde für eine Geschmacksanalyse auch von Forschern verkostet, sagte Angelika Schartl von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim bei Würzburg.
„Ziel des Forschungsprojekts ist in erster Linie, die Widerstandsfähigkeit der Weinstöcke gegen Pilze zu erhöhen“, erläutert die Biologin, die das fränkische Projekt leitet. Damit solle der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringert werden. Wissenschaftler hatten den Reben dazu vorab zwei Gene der Gerste eingesetzt.
Am 22. Juli 1999 hatten Forscher im rheinland-pfälzischen Siebeldingen erstmals in Deutschland transgene Weinstöcke ins Freiland gepflanzt. Das dortige Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof forscht mit transgenen Reben der Sorten Riesling, Dornfelder und Seyval blanc. Eine Woche später wurden am Würzburger Pfaffenberg rund 80 Riesling-Reben gepflanzt.
„Unser Interesse richtet sich darauf, zu fragen, wie sich die Pflanze in der Vegetationsperiode entwickelt“, sagt der Leiter des Instituts in Siebeldingen, Reinhard Töpfer. Der Versuch sei nicht auf kommerzielle Interessen ausgerichtet. Auch die Veitshöchheimer Projektleiterin Schartl ist bemüht, keine Spekulationen um einen „Gen-Riesling“ für den Weinmarkt aufkommen zu lassen. „Das ist ein reines Forschungsprojekt mit dem Ziel, Erfahrungen mit transgenen Pflanzen im Freiland zu sammeln und nicht mit dem Ziel, Verbraucherweine zu machen“.
Die Freisetzung des „FranGenweins“ war nach der Genehmigung durch das Robert Koch-Institut von Protesten durch Umweltschützer und Ökowinzer begleitet worden. Sie fürchten unkalkulierbare Risiken. Der Bund Naturschutz verurteilte den Versuch als einen „Anschlag auf die fränkische Weinkultur. „Dieses Projekt ist moralisch bedenklich. Und das ist erst der Anfang“, kritisiert Johann Schnell vom Öko-Winzer- Verband „ECOVIN“.
„Wir sehen darin keinen Nutzen für die Winzer. Das ist eine sinnlose Züchtung“, betont Öko-Winzer Schnell. Stattdessen hätten Winzer bereits durch die herkömmliche Züchtung große Erfolge bei der Entwicklung von pilzresistenten Pflanzen erzielt. „Öko und Gentechnik sind zwei Sachen, die sich nicht widersprechen“, meint hingegen Biologin Schartl. „Wir machen im Grunde genommen Umweltschutz, wenn wir Pflanzen auf den Markt bringen, die pilzresistent sind“.
Im Versuchsfeld am Würzburger Pfaffenberg trägt nun jede dritte Pflanze in der Reihe ein kleines Zettelchen, das auf den Gen-Wein hinweist. Die mittlerweile insgesamt etwa 540 gentechnisch veränderten Pflanzen sind von „natürlichen“ Artgenossen umgeben, die Pollen abfangen sollen. Eine Auskreuzung in freier Natur sei bei der Rebe nahezu auszuschließen, sagt Schartl. „Zu 90 Prozent ist die Rebe selbstbefruchtend“, betont die Biologin. Wilde Kreuzungspartner gebe es, anders als beispielsweise beim Raps, nicht.
Noch werden die transgenen Riesling-Weinstöcke wie herkömmliche Weinstöcke zum Schutz vor Mehltau oder Grauschimmel mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Im laufenden Jahr soll die Dosis allerdings deutlich verringert werden. „Wie widerstandsfähig gentechnisch veränderte Pflanzen oder einzelne Linien letztlich sind, zeigt sich erst nach Jahren mit größerem Pilzbefall im Weinberg“, meint Schartl.
An einem Gewächshaus im Weinberg hat die Landesanstalt auch ein molekularbiologisches Labor eingerichtet. Die begleitende Sicherheitsforschung soll zeigen, wie sich die übertragenen Gene auf Pilze und Umwelt auswirken. „Sicherheitsstufe 1“ kündigt ein Schild im Gebäude an. In einem großen hellen Raum liegen Keime von Trauben in durchsichtigen Schälchen, klein geriebene Blätter werden hier mit flüssigem Stickstoff schockgefroren.
Erste Forschungsergebnisse gibt es laut Projektleiterin Schartl bereits. „Zuerst hatten wir gedacht, dass bei der Weinbereitung so viel mit dem Wein passiert, dass das genetische Material abgebaut wird und nicht mehr nachgewiesen werden kann“, sagt die 47-jährige Forscherin. Allerdings seien in jungem Wein durchaus noch genetische Spuren zu finden. Weitere Analysen sollten zeigen, in welcher Stecklings-Generation die Gene verloren gehen. Das Forschungsprojekt läuft zunächst bis Ende 2009.
Claudia Möbus