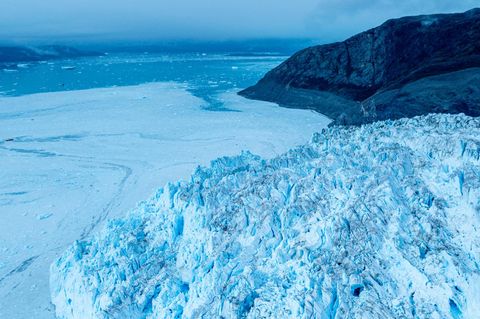Deutschlands Winzer sind empört: Billiger Kunstwein aus den USA soll bald den freien Zugang nach Europa bekommen. Und kein Hinweis auf dem Etikett wird dann zeigen, ob ein Wein mit Wasser verdünnt oder mit Pfirsicharoma geschönt wurde. So jedenfalls sieht es das neue Weinhandelsabkommen zwischen der EU und den USA vor, das den EU-Agrarministern bei ihrem Treffen am 19. und 20. Dezember zur Unterschrift vorliegt.
Verunsicherung der Verbraucher befürchtet
Den Protesten des deutschen Weinbauverbandes DWV hat sich nun auch der Verband der Prädikatsweingüter VDP angeschlossen. VDP-Präsident Michael Prinz zu Salm fürchtet von den "Coca-Cola-Weinen" aus den USA zwar keine direkte Konkurrenz für deutsche Topweine, aber doch eine tiefe Verunsicherung der Verbraucher. "Schon jetzt werden 70 Prozent aller Weine in Supermärkten gekauft", sagt Salm. "Da wird der Verbraucher nur über das Etikett angesprochen."
Salm sieht die Ideale des deutschen Weinbaus ad absurdum geführt: In Deutschland gilt Wein als kunsthandwerkliches Kulturgut, geprägt von Boden, Klima und dem Können der Winzer. Auf der anderen Seite entwickele sich Wein mehr und mehr zum Industrieprodukt, das als "Designerwein" beliebig dem Konsumentenprofil angepasst werden kann.
Wein als industrielle Ware
In den USA sind für Wein Produktionsmethoden zugelassen, die in der Europäischen Union verboten sind. Dazu gehören Wasserzusätze und die "Fraktionierung" des Weins, ein Schleuderverfahren, um die Bestandteile zu trennen und beliebig mit Aromazusätzen wieder zusammenmischen zu können. Auch die teure und lange Lagerung im Eichenfass zur Anreicherung der Tannine edler Weine kann man in den USA umgehen, indem einfach Holzchips in Stahltanks geworfen werden.
Zwar hat das Weltweininstitut OIV einen internationalen Standard für die Weinproduktion ausgearbeitet, aber die USA sind im jahrelangen Streit mit den Europäern aus der Organisation ausgetreten. Scheitert das neue Handelsabkommen, kann Washington den Import durch ein strenges Zertifizierungsverfahren für Weine behindern. Berühmte deutsche edelsüße Beerenauslesen und Eisweine würden ganz die Zulassung verlieren, weil sie oft weniger als sieben Prozent Alkohol haben, in USA also gar nicht als Wein gelten.
Europäische Namen besser schützen
Die EU-Kommission sieht dagegen das Ziel erreicht, den wichtigsten Absatzmarkt für europäische Weine in den USA zu bewahren und auch europäische Weinnamen endlich besser als Ursprungsbezeichnungen zu schützen. Namen wie Mosel, Champagner, Chianti oder Sherry werden in USA heute beliebig als "Pseudo-Bezeichnungen" für Wein benutzt. Künftig sollen 17 solcher Namen geschützt werden, nicht aber die deutschen Beerenauslesen und Eisweine. Der Weinbauverband DWV sieht dies als unzureichend an und fordert Nachbesserungen.
Eine Öffnung der Märkte für die US-Weine scheint kaum abzuwenden, da die meisten Weinländer der EU Absatzprobleme haben und Sanktionen der USA vermeiden wollen. Andererseits wird beim Weinbauverband befürchtet, dass der Vertrag mit den USA die Schranken für billige Designer-Weine auch aus anderen Überseeländern mit günstigen klimatischen Bedingungen öffnet. Salm sieht in Deutschland viele mittelgroße Winzerbetriebe durch die stärkere Konkurrenz gefährdet.
Erkennbares Reinheitsgebot fehlt noch
Der Verband der Prädikatsweingüter hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Vorzüge der deutschen Weine besser herauszuheben. "Uns hilft nur noch ein klar erkennbares Reinheitsgebot für deutschen Wein", sagt Salm. "Dann kann sich der Verbraucher frei entscheiden." Auch der als Qualitätsfanatiker bekannte VDP-Winzer Reinhard Löwenstein von der Mosel ist für ein Reinheitsgebot wie beim Bier. "Nur kontrollieren muss man es besser."