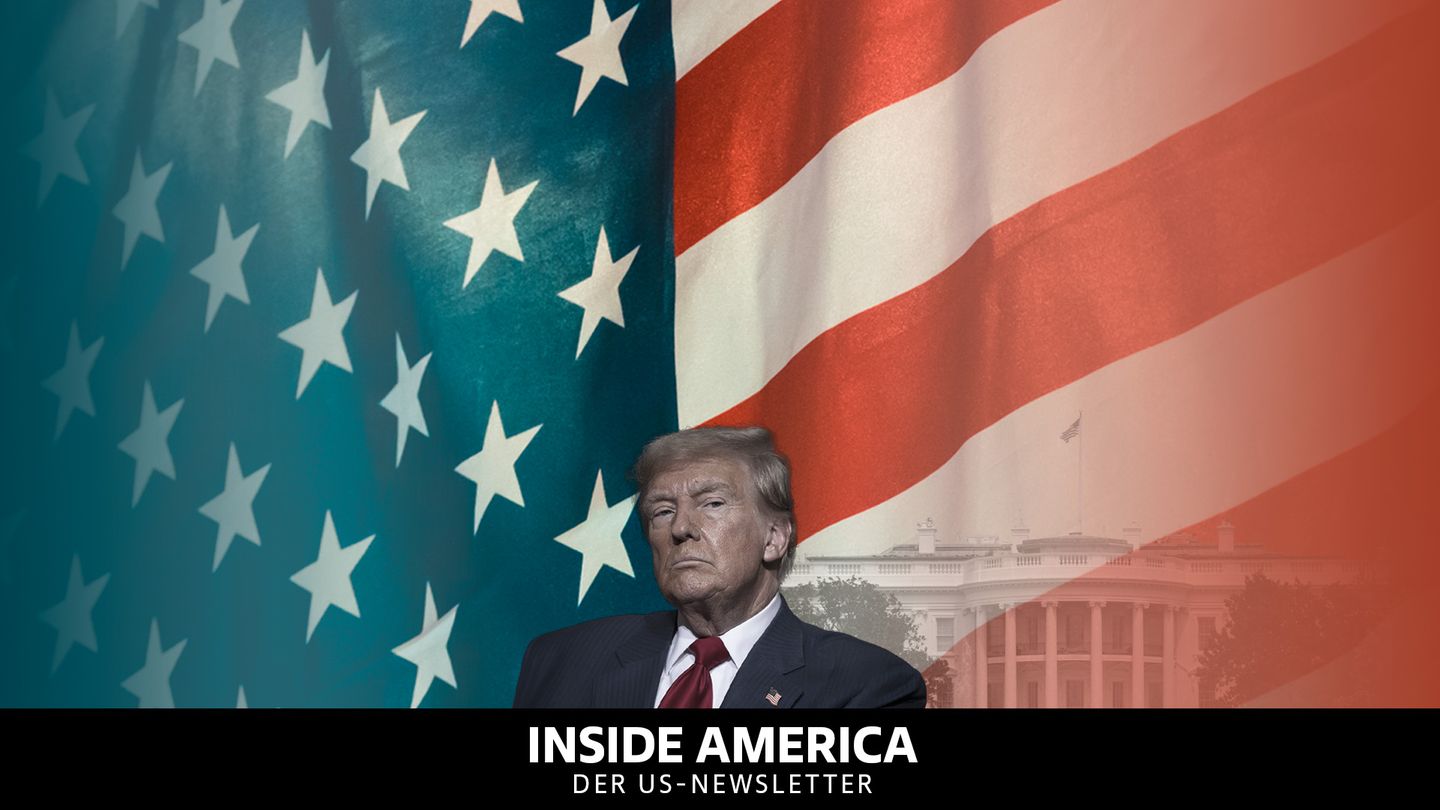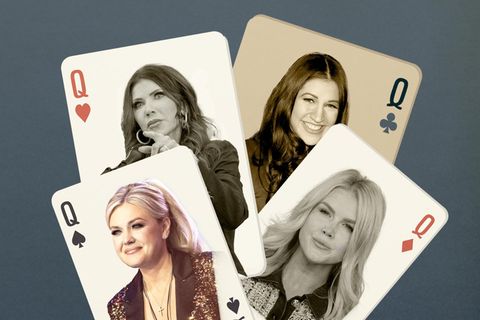Immer samstags erzählt das stern-Team vor Ort über die wichtigsten Entwicklungen, erzählt Geschichten aus den Bundesstaaten und blickt auf besondere Menschen und Ereignisse.
Haben Sie die letzte Ausgabe des Newsletters verpasst? Hier können Sie alle Folgen des USA-Newsletters nachlesen.
Inside America

Mit dabei: ein Präsidentenbaby und eine Volksbilanz
Fremde Nachbarn
Liebe Leserinnen und Leser,
wer die echten Vereinigten Staaten von Amerika sucht, der findet sie nicht an den Küsten, nicht in den viktorianischen Reihenhäuschen in Washington, nicht in den Co-Working-Spaces im Silicon Valley. Das Herz dieses Landes schlägt in seinem oft überflogenen Zentrum. Und gerade dort spürt man, wie zerrissen es ist.
Für eine Recherche bin ich gerade in Colorado. Es ist ein Miniatur-Amerika, skaliert auf ein Rechteck von 270.000 Quadratkilometer Größe. Stundenlanges Highway-Nichts, dann Downtown Denver, dann Berge und Bären. Doch dieser Bundesstaat wird nicht nur von den zauberhaften Rocky Mountains durchtrennt, sondern auch von einem tiefen politischen Canyon.
Auf der einen Seite: Örtchen wie Cheyenne Wells, kaum 1000 Einwohner, eine Kneipe, in der Brauereien mit Tafeln werben, auf denen etwa steht: "Die Mädels hier servieren eiskaltes Bier". Die Dorfbewohner sprachen über die Vorstädte Denvers, als wären sie eine Pforte zur Unterwelt. Dahinter regieren Drogen, Waffen und die Demokraten.
In den Bars von Denver hängen dagegen einige Regenbogenflaggen. Von einer Gruppe Studenten wurde ich in einen Jazzclub mitgeschleppt. Als ich nach ihren Landsleuten in der weiten Ebene fragte, starrten sich mich an, als spräche ich von trumpifizierten Zombies in der Prärie. Cheyenne Wells? Nie gewesen, da draußen.

Stolz auf die Flagge und eiskaltes, von Frauen serviertes Bier: Kneipe in Cheyenne Wells, Colorado. Fabian Huber
Diese beiden Orte trennen mehr als nur 300 Kilometer. Sie repräsentieren zwei Amerikas, die sich vollständig voneinander entfremdet haben. Die liberale Stadt, das konservative Land.
In der Dorfkneipe kam ich bald ins Gespräch mit Besitzerin Barb. Sie hatte einige Jahre in Heidelberg gelebt, war dann nach Florida gezogen, später nach Phoenix in Arizona, gut rumgekommen in diesem Land und dieser Welt. Sie hatte Trump gewählt, konnte aber nicht akzeptieren, wie er über Minderheiten spricht oder über Grönland.
Barbs Bar heißt "The Gap", die Lücke. Aber an diesem Abend, da wollte sie die Gräben zuschütten. Barb rief: "Auch wenn man nicht derselben Meinung ist wie wir, muss man doch noch miteinander reden können." Das taten wir. Fast zwei Stunden lang. Ich versprach wiederzukommen, irgendwann, in besseren, weniger gespaltenen Zeiten hoffentlich. Der letzte Drink ging aufs Haus.
See you around!
Fabian Huber
aus Denver, Colorado
aus Denver, Colorado

Rückblick
Ein Jahr dauert die zweite Amtszeit von Donald Trump nun – erst, möchte man fast sagen. Denn die politischen Volten, die im Weißen Haus in dieser Zeit geschlagen wurden, könnten ein halbes Jahrzehnt füllen: US-Stahlkappenbomber im Iran, Putin in Alaska, Maduro in einem New Yorker Knast, die Abschiebesöldner von der ICE in ihren schwarz getönten Vans, Zölle gegen die ganze Welt und ein Trump-Club als UN-Ersatz. US-Korrespondentin Leonie Scheuble hat mit Amerikanern aus dem ganzen Land einmal Revue passieren lassen, wie sie die Zeit seit Trumps Wiederantritt erleben (+).

Einblick
Auch als US-Präsident ist Donald Trump ein Geschäftsmann geblieben. Er vertickt seine eigene Bibel, investiert über ein Firmengeflecht in Krypto und scheut sich auch nicht davor, millionenschwere Geschenke anzunehmen. Meine Kollegen Nils Kreimeier und Marc Etzold zeichnen nach, wie Trump sich im Amt bereichert (+).

Ausblick
In einer Sache hält J. D. Vance Wort: "Ich will mehr Babys für die Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Trumps Vize bei einer Demonstration von Abtreibungsgegnern in Washington im vergangenen Jahr. Nun verkündeten er und seine Frau Usha, dass sie für diesen Sommer ihr viertes Kind erwarten. Ein historischer Moment: Die letzte schwangere Second Lady hieß Ellen Wade Cofax und gebar im Jahr 1870.
Es war einmal in Amerika

Es war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Computers, auch wenn Steve Jobs (l.) und sein Partner John Sculley mit Fliege und Krawatte nicht wirklich wie Revoluzzer wirken. Auf der Apple-Konferenz im Januar 1984 präsentierten die beiden den Macintosh, den ersten kommerziell erfolgreichen Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Den ließ Jobs auch mit einem spektakulären Werbespot, der sich an Orwells "1984" anlehnte, in der Halbzeitpause des Super-Bowls bewerben. Ridley Scott führte die Regie – auch das war damals revolutionär.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein sehr teures Frühstück in New York
Die mutigen Amerikaner, die sich gegen Trumps Häscher stellen
Liebe Leserinnen und Leser,
zurück aus dem Weihnachtsurlaub kommt es mir in Washington nun vor, als seien Monate vergangen, man erkennt die Welt kaum wieder. Wir sind hier in D.C. inzwischen einiges gewohnt, aber derzeit herrscht selbst für Trump'sche Verhältnisse großes Chaos. Man wagt nicht vorauszusagen, was der kommende Tag bringt: Berauscht von der Entführung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro droht der Präsident abwechselnd mit Angriffen auf den Iran und einer Übernahme Grönlands. Und auch innenpolitisch steht Amerika unter Hochspannung.
Seit ein ICE-Beamter am 7. Januar in Minneapolis die 37-jährige Renée Nicole Good erschossen hat, herrscht in der Stadt der Ausnahmezustand (+). Während Trump inmitten laufender Ermittlungen das Narrativ von Good als "linker Terroristin" verbreitet, verdoppelt seine Regierung die Präsenz der ICE-Leute in Minneapolis. Sie durchkämmen Wohnviertel und Geschäfte nach illegalen Einwanderern und gehen dabei zunehmend aggressiv vor – dabei sind viele von ihnen gar nicht für solche Einsätze geeignet (+).
"Es fühlt sich an, als würden wir von unserer eigenen Regierung belagert", so beschreibt mir Francisco Segovia, Leiter des Latinonetzwerks Copal in Minnesota, die Stimmung. Eigentlich setzt sich seine Organisation für die Rechte lateinamerikanischer Arbeitnehmer ein. Doch seit die Abschiebeoperationen im Herbst verschärft wurden, ist Copal zur Notrufstelle für Betroffene von ICE-Razzien geworden.

Seit Goods Tod kommt es im ganzen Land wie hier in Syracuse (US-Staat New York) zu Anti-ICE-Protesten. Alex Hamer / IMAGO
Mehr als 300 Anrufe gehen dort täglich ein: von Menschen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen; von Eltern, die Begleitung für den Schulweg ihrer Kinder suchen; von Angehörigen, die verzweifelt nach Rechtsbeistand für Familienmitglieder in Abschiebehaft fragen. Segovia, der 1990 aus El Salvador in die USA kam, spricht von "rassistischem Profiling". ICE sei es egal, ob jemand eine Arbeitserlaubnis habe oder US-Bürger sei. "Sie greifen wahllos Menschen mit brauner Hautfarbe auf", sagt er. "Viele von uns erinnert das an Zustände, vor denen wir einst geflohen sind."
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Egal, wie viel Unruhe Donald Trump derzeit außenpolitisch stiftet, das Top-Thema für die Zwischenwahlen zum Kongress im November ist bereits gesetzt: die hohen Lebenshaltungskosten. Und wohl nirgendwo zeigt sich der Preiswahnsinn so deutlich wie in New York. Mein Kollege Fabian Huber hat dazu ein Experiment gemacht. Er hat versucht, sich die Zutaten für ein ganz normales Frühstück zu besorgen, ohne dafür mehr als 15 Dollar auszugeben (+).

Einblick
Steffen Gassel kennt den Iran von vielen Recherchen ziemlich gut. Er war auch einer der ersten Reporter, der nach den zwölftägigen Angriffen Israels und der USA im vergangenen Jahr aus dem Iran berichtet hat. Trotz der Zerstörung, trotz der Todesopfer schienen die Menschen damals zu hoffen, so sein Eindruck, dass sich das Regime öffnen könnte, dass der Druck aus dem Ausland etwas bewirken könnte. Heute weiß er nicht, ob seine Gesprächspartner von damals noch am Leben sind (+). Das Regime hat die seit mehreren Wochen andauernden Proteste brutal niedergeschlagen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Tausenden Todesopfern. Donald Trump droht mit einem Angriff, doch die USA haben derzeit keinen Flugzeugträger in der Region, was die Logistik erschwert. Und auch die Golfstaaten sind davon nicht überzeugt.

Ausblick
Donald Trump will sich Grönland einverleiben – und schließt auch einen Militäreinsatz nicht aus. Jeremy Shapiro, einst außenpolitischer Berater von Barack Obama, malt im Interview ein anderes Szenario aus (+): die schrittweise Unterwanderung der dänischen Kontrolle, die Grönland am Ende nolens volens zu einem Assoziierungsabkommen mit den USA zwingen könnte.
Fotofinish

Actionpress/CATERS/SIPA
Sie sehen hier kein als Wal getarntes U-Boot, in dem sich Navy Seals auf Befehl von Donald Trump aufmachen, die grönländische Regionalregierung festzusetzen. Sie sehen tatsächlich und schlicht: einen Grauwal, genauer gesagt eine Mutter mit ihrem Kalb in trauter Zweisamkeit. Einem Fotografen gelang diese Aufnahme mit einer Drohne vor der Küste Kaliforniens. Die Grauwale ziehen derzeit über mehrere Tausend Kilometer von Alaska bis hinunter nach Baja California. So wie sie es eben schon immer taten – eine Konstante in einer sich wahnsinnig schnell verändernden Welt.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein verkasstes Hollywood-Paar und ein besonderes Foto
Zwischen ICE und Eishockey
Liebe Leserinnen und Leser,
Bei meinem allerersten Besuch in Washington – es war 2017 und Trump gerade erstmals Präsident geworden – landete ich eines Abends in einem Pub im hippen Viertel Georgetown. Neben mich setzte sich ein bierschwangerer Finne. Beim Small Talk stellte sich heraus, dass er wegen eines Nato-Forums angereist war und in der Heimat für die Rechtspopulisten im Parlament saß. Am Ende lallte er irgendwas von "Wehrmacht", "Stolz" und "Drittes Reich".
Bei meinem allerersten Besuch in Washington – es war 2017 und Trump gerade erstmals Präsident geworden – landete ich eines Abends in einem Pub im hippen Viertel Georgetown. Neben mich setzte sich ein bierschwangerer Finne. Beim Small Talk stellte sich heraus, dass er wegen eines Nato-Forums angereist war und in der Heimat für die Rechtspopulisten im Parlament saß. Am Ende lallte er irgendwas von "Wehrmacht", "Stolz" und "Drittes Reich".
Es sind Begegnungen, wie man sie nur in der mächtigsten Stadt der Welt erlebt. Irgendwo hat irgendwer hier immer irgendwas aus seinem meist doch recht interessanten Lebenslauf zu referieren.
Am Mittwoch ging ich nach Feierabend noch ins Eisstadion. Die Partie verlief schleppend, das Gastteam aus Dallas führte nach drei Minuten, ich plauderte also mit meinem Nebenmann. Nennen wir ihn Dan. Unter Dans Trikot lugte ein Hemdkragen hervor. Wir kamen recht schnell auf seinen Job zu sprechen: Er habe lange für die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA gearbeitet. Erst in Chicago, später in der Außenstelle auf den Bahamas.

Nicht bloß ein Ort, um das weltbeste Eishockey zu sehen: Capital One Arena, Heimstätte des NHL-Clubs Washington Capitals. Foto: Fabian Huber
Ein treffender Zufall, schließlich hatte Trump erst vor wenigen Tagen in der Karibik den venezolanischen Machthaber Nicólas Maduro festnehmen (+) – man könnte auch sagen: kidnappen – lassen. Wegen angeblicher Verstrickungen in den Kokainhandel. Was vor Gericht noch zu beweisen wäre. "Oh no!", intervenierte Dan. "Zu 100 Prozent" habe Maduro mit den Kartellen unter einer Decke gesteckt. Und "hell yeah!", natürlich könne man diesen Mann gewaltsam stürzen. "Wir haben ihm so viele Auswege geboten. Er hätte doch einfach nach Moskau gehen können!" Dans Theorie: Spätestens, als Maduro auf offener Bühne Trumps Tanzstil imitierte, sei es dem US-Präsidenten zu bunt geworden.
Mein Sitznachbar schwatzte noch ein wenig darüber, wie die DEA einst Carlos Lehder, dem deutschen Komplizen von Drogenbaron Pablo Escobar, auf die Schliche kam (der stern hat Lehder kürzlich erst interviewt (+)). Zu Dans Zeit im Pentagon kamen wir leider nicht mehr. Die Partie neigte sich dem Ende zu. Washington verlor übrigens mit 1:4.
See you around!
Fabian Huber
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Es war purer Zufall, dass vor einem Jahr der Feuersturm in Los Angeles ein unbekanntes Familienfoto vor das Grundstück von Cheryl Heuton wehte. Der Anblick eines darauf abgebildeten Elternpaares mit Baby bewegte die 63-Jährige, hatten doch um sie herum gerade viele Menschen ihre wichtigsten Erinnerungsstücke im Feuer verloren. Sie machte sich auf die Suche nach den Besitzern des Fotos – und fand Annatova Neches. Zum Jahrestag der Katastrophe haben die beiden sich getroffen. Ich war dabei (+).

Einblick
Mit kruden Mitteln soll die Einwanderungsbehörde ICE Deportationen durchsetzen. Immer mehr US-Amerikaner stellen sich dem in den Weg. Auch die 37-jährige Renee Nicole Good aus Minneapolis. Am Mittwoch blockierte sie mit ihrem SUV einen Konvoi der Abschiebepolizisten. Die Beamten forderten Good auf, aus ihrem Wagen zu steigen. Sie weigerte sich, wollte davonfahren – und wurde erschossen. Der Fall dürfte die Proteste gegen ICE noch weiter anheizen. Mein Kollege Marc Etzold hat dazu eine klare Meinung: "Trumps Amerika", kommentiert er, "ist ein Polizeistaat" (+).

Ausblick
Sie bleiben ja häufig unter sich, die Stars und die Sternchen. So ist das auch mit Schauspieler Timothée Chalamet, 30, und Glamour-Girl Kylie Jenner, 27. Wieso sie als meistgehasstes Pärchen Hollywoods gelten, erfahren Sie in diesem Text von Jana Felgenhauer (+). Am Samstag werden die beiden gemeinsam über den roten Teppich in Beverly Hills stelzen, zur Verleihung der Golden Globes, quasi die Aufwärmveranstaltung für die Oscars. Chalamet ist nominiert für seine Hauptrolle in "Marty Supreme". Er mimt darin einen selbstbewussten Tischtennisspieler, der eine Affäre mit einer älteren Filmdiva eingeht.
Es war einmal in Amerika

Foto: CSU Archives/Everett Collection/Picture Alliance
Routiniert lächelnd nimmt sie den Blumenstrauß kurz nach ihrer Ankunft auf dem Regionalflughafen von Oakland (Kalifornien) entgegen. In den letzten Stunden vor der Landung habe sie sich entspannt und eine Übertragung aus der New Yorker Met Oper angehört, wird Amelia Earhart im Anschluss erzählen. Es ist der 11. Januar 1935 und die 37-Jährige hat gerade als erster Mensch solo die Strecke von Hawaii bis an die US-Westküste im Flugzeug zurückgelegt – zu diesem Zeitpunkt längst nicht ihr erster Rekord. Als weibliche Ikone der Luftfahrt ist die Pilotin in die Geschichte eingegangen, ihr Flugzeug von damals gibt es als Lego-Version, sie selbst als Barbie-Edition. Zahlreiche Bücher und Filme dokumentieren ihre einzigartige Lebensgeschichte und auch ihr tragisches Ende: 1937 verschwand ihre Maschine beim Versuch, als erste Frau die Erde zu umfliegen, über dem Pazifik. Earharts Leiche wurde nie gefunden.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: eine redefreudige Stabschefin und sehr, sehr viele Kürbisse
Tausende Seiten Brisanz – die Epstein-Akten
Liebe Leserinnen und Leser,
seit Wochen hatten alle hier in Washington, die sich mit Politik beschäftigen, und das sind sehr viele Menschen, einen Tag im Blick: den 19. Dezember. An diesem Tag, also gestern, lief die Frist aus, innerhalb derer die Epstein-Akten veröffentlicht werden mussten.
Die Epstein-Saga hatte einen Keil zwischen Trump und seine MAGA-Basis getrieben. Noch im Wahlkampf hatte Trump versprochen, den Skandal aufzuklären und die Akten zu veröffentlichen. Mit seinem Amtsantritt kam die Kehrtwende. Plötzlich begann er, die Angelegenheit als "demokratischen Schwindel" herunterzuspielen und drohte Republikanern, die sich weiterhin für die Veröffentlichung einsetzten. Doch der Druck ließ nicht nach. Im November sah sich der Präsident gezwungen, ein Gesetz zur Freigabe der Akten zu unterzeichnen.
In den vergangenen Wochen wurden nun im Justizministerium hektisch Tausende Seiten an Akten gesichtet, wurden Namen geschwärzt, schließlich wurde gestern tatsächlich eine erste Tranche veröffentlicht. Aber es wurden eben noch nicht alle Akten online gestellt. Epsteins Opfer wie auch demokratische Abgeordnete kritisieren bereits, die Regierung käme so nicht ihrer gesetzlichen Pflicht nach.
Es sind Gerichtsdokumente und auch wieder Fotos, bei vielen lässt sich nicht genau sagen, wann und in welchem Kontext sie entstanden sind. Auffallend viele zeigen Ex-Präsident Bill Clinton, das dürfte kein Zufall sein. Donald Trump hatte schon in der Vergangenheit versucht, den Blick auf Clinton zu lenken, um von seiner eigenen engen Beziehung zu Epstein abzulenken. Wichtig bei all dem ist: Allein, dass eine Person auf einem Foto zu sehen ist, oder dass ihr Name in einem Dokument erscheint, sagt noch nichts darüber aus, dass diese Person über die Straftaten von Jeffrey Epstein Bescheid wusste oder gar beteiligt war.
Über alle Entwicklungen halten wir Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Ein riesiges Plakat vor dem US-Kapitol zeigt Jeffrey Epstein (l.) und Donald Trump. Heather Diehl / Getty
Die Epstein-Akten, das ist die Hoffnung, sollen endlich Klarheit darüber schaffen, wie Epstein sich jahrzehntelang der Justiz entziehen konnte – und wer ihm dabei half. Denn auch sechs Jahre nach dem Tod des verurteilten Sexualstraftäters liegt der Großteil seines mächtigen Netzwerks im Dunkeln. Donald Trump (+), Bill Clinton (+) und Prinz Andrew (+) sind nur einige der prominenten Namen auf einer langen Liste von Männern, die Epsteins Villen besuchten und in seinen Privatjets flogen, wo es von jungen Frauen stets nur so wimmelte. Aber kein Einziger will etwas Verdächtiges gesehen oder getan haben.
Die kommenden Tage und Wochen könnten nun die eine oder andere Lüge entlarven.
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.
P.S.: "Inside America" verabschiedet sich in eine zweiwöchige Weihnachtspause. Wir lesen uns am 11. Januar 2026 wieder. Ihnen bis dahin erholsame Feiertage!

Rückblick
Es war eine Woche, in der intensiv über einen möglichen Frieden in der Ukraine verhandelt wurde – und auch darüber, wie man die Ukraine finanziell über Wasser hält. Es sprachen allerdings nur die Europäer, die Ukrainer und die Amerikaner miteinander. Was die Russen davon halten? Der Eindruck meiner Kollegin Bettina Sengling aus Moskau: Russland schert sich wenig um all die Vorschläge, Putin spielt auf Zeit – und an der Oberfläche, im Alltag, spielt der Krieg ohnehin kaum eine Rolle. (+)

Einblick
Es gibt zwei Institutionen, um die Großbritannien lange in der Welt beneidet wurde. Die Royals. Und die BBC. Um beide steht es allerdings dieser Tage nicht zum Besten. Donald Trump hat den britischen Sender nun auf zehn Milliarden US-Dollar verklagt, weil deren Journalisten ein Zitat von ihm falsch zusammengeschnitten hatten. Meine Kollegin Dagmar Seeland in London verfolgt die Unruhe bei der Anstalt seit Langem. Sie fragt sich immer häufiger: Was ist bloß bei der BBC los? (+)

Ausblick
Donald Trump gibt sich mächtig und unantastbar. Parteifreunde wie ausländische Regierungschefs buhlen um seine Gunst. Doch tatsächlich hat sein Abstieg längst begonnen. Man muss nur etwas genauer hinschauen. Von ihm gestützte Kandidaten verlieren Wahlen, seine Zustimmungswerte sinken. Gerade das Jahr 2026 könnte ihm gefährlich werden. (+)
Fotofinish

Reuters
Stammte diese Aufnahme aus einem Horrorfilm zur Halloweenzeit, dann wäre der passende Titel: Die Invasion der Superkürbisse. Natürlich, Sie wissen es, zeigen wir Ihnen aber kein Kino, sondern die Realität. Der US-Bundesstaat Washington an der pazifischen Nordwest-Küste wird gerade von Überschwemmungen heimgesucht, mehrere Hunderttausend Menschen waren zeitweise ohne Strom. Überflutet wurden auch Felder mit Kürbissen, wie hier bei der Stadt Snohomish, die dann an einer Straße angetrieben wurden.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein wütender Nobelpreisträger und schmeichelnde Europäer
Ein Abend Friede in Washington
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal gibt es ihn doch noch, den überparteilichen Konsens im polarisierten Amerika. Am Dienstagabend war ich in der Washington National Cathedral, als die Gouverneure Josh Shapiro, Demokrat aus Pennsylvania, und Spencer Cox, Republikaner aus Utah, dort über die politische Gewalt im Land sprachen. Sie waren sich einig: Die Vereinigten Staaten befinden sich gefährlich nah an einem Kipppunkt. Und Shapiro und Cox wissen, wovon sie reden.
In einer Nacht im April versuchte ein Mann, das Haus von Shapiro abzufackeln. Cox wiederum war einer der wenigen Konservativen, die nach der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk öffentlich für Mäßigung und für Zusammenhalt eintraten. "Wir bewegen uns in Richtung eines gescheiterten Staats und eines Bürgerkriegs", warnte Cox. "Wenn wir jetzt keine Kurskorrektur vornehmen, werden wir genau dorthin gelangen."
In der vollbesetzten Kathedrale war auch eine USAID-Mitarbeiterin. Genauer gesagt: eine ehemalige Mitarbeiterin – denn die Behörde für Entwicklungszusammenarbeit wurde ja von der Trump-Regierung fast vollständig abgewickelt. "Es kann nicht wahr sein, dass wir zu Waffen greifen, anstatt miteinander zu streiten", sagte sie, als das Publikum sich zu Wort melden konnte. Leider ist genau das die Realität.

NBC-Moderatorin Savannah Guthrie im Gespräch mit den Gouverneuren Josh Shapiro (M.) und Spencer Cox. stern
Hinter den USA liegen zwei Jahre, die von politischer Gewalt geprägt waren wie selten zuvor in der jüngeren Geschichte. Nur ein paar Beispiele: Zweimal versuchten Attentäter, Donald Trump zu töten. Die demokratische Abgeordnete Melissa Horman wurde in Minnesota ermordet. Und hier in Washington schoss ein Mann erst vor wenigen Wochen auf Nationalgardisten, eine Frau starb an den Folgen.
Shapiro und Cox kritisierten ihre eigenen Parteien dafür, dass sie nicht genug täten, um den politischen Diskurs abzukühlen. "Wir müssen damit beginnen, dass alle Politiker jede Form von politischer Gewalt verurteilen – erst recht, wenn sie aus dem eigenen Lager kommt", sagte Shapiro. "Und wir haben derzeit einen Präsidenten, der diesen Test täglich nicht besteht."
Shapiro und Cox kritisierten ihre eigenen Parteien dafür, dass sie nicht genug täten, um den politischen Diskurs abzukühlen. "Wir müssen damit beginnen, dass alle Politiker jede Form von politischer Gewalt verurteilen – erst recht, wenn sie aus dem eigenen Lager kommt", sagte Shapiro. "Und wir haben derzeit einen Präsidenten, der diesen Test täglich nicht besteht."
Es folgte der lauteste Applaus an diesem Abend.
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Joseph Stiglitz ist ziemlich sauer auf Donald Trump. Der Wirtschaftsnobelpreisträger hat für die G20 einen Bericht über die weltweit wachsende Ungleichheit verfasst. Doch Trump, der die G20-Präsidentschaft jüngst übernommen hat, ließ den Report einfach löschen. Stiglitz wirft dem US-Präsidenten im Interview mit meinem Kollegen Marc Etzold vor (+) , dass er die Armut dramatisch befördere. Im Ausland – aber auch in den USA selbst.

Einblick
Wer den Antiquitätenladen "Uncommon Objects" in Austin betritt, taucht ein in ein Amerika aus einer anderen Zeit. Die Luft riecht nach altem Holz, aus dem Radio tönen Songs der 70er-Jahre. Von Schallplattenraritäten bis zu einem Tagebuch von 1901 findet man in den vollgestopften Gängen so ziemlich alles. Eine sehr nostalgische Mischung, man fühlt sich irgendwie, als tränke man einen warmen Tee bei Regenwetter. Das zieht auch Prominente wie Johnny Depp und Whoopi Goldberg an (+).

Ausblick
Jocelyn Samuels wird den 27. Januar 2025 nie vergessen. Der Tag, an dem sie von Donald Trump als Gleichstellungskommissarin gefeuert wurde. "Es war wie ein Schlag ins Gesicht", sagte mir die Demokratin, als ich sie vor ein paar Tagen in ihrem Zuhause besuchte. Samuels ist nicht allein. Rund 300.000 Staatsbedienstete hat die Trump-Regierung bisher gefeuert. Wie andere zog auch sie vor Gericht. Nun entscheidet der Supreme Court über einen ähnlichen Fall, dessen Urteil gravierende Folgen haben dürfte – auch für Samuels (+).
Es war einmal in Amerika

Picture Alliance
Dichte Rauchwolken steigen über der "Arizona" auf, das Schiff wird kurz darauf sinken, mehr als 1000 Seeleute sterben. Der japanische Angriff auf die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 war der wohl entscheidende Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs – die USA traten daraufhin in den Krieg ein. Pearl Harbor war auch eine Wegmarke für das gesamte 20. Jahrhundert. Die Zeit des Isolationismus in den USA war vorbei, das Land begann, sich in der Welt zu engagieren, wurde für viele Menschen zum Symbol für Freiheit – trotz manch fragwürdiger Entscheidungen, die folgen würden. Der 7. Dezember 1941 war ein trauriger Tag, viele Menschen verloren ihr Leben. Aber es war, aus der Sicht des Jahres 2025, auch ein bemerkenswerter Tag.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein Rätsel um ein ikonisches Foto und das Who's who der Friedensgespräche
Was Trumps Nachbar von ihm hält
Liebe Leserinnen und Leser,
schräg gegenüber des Weißen Hauses liegt "White House Gifts". Von außen wirkt der Laden wie einer der vielen Souvenirshops in Downtown, drinnen aber merkt man schnell, dass hier etwas anders ist. Wer den Laden von Jim Warlick betritt, wird nicht einfach bedient, sondern geführt. White-House-Magnete, Präsidentensocken – sogar eine Plüsch-Air-Force-One gibt es hier. So weit, so normal. Nur die Ecke mit den Trump-Devotionalien zeigt der 73-Jährige eher widerwillig. "MAGA-Mützen? Verkaufe ich nicht", sagt er, auch wenn Leute ständig danach fragten. "Ich wurde als Demokrat geboren. Und ich werde als Demokrat sterben."
Schon als Jugendlicher war Warlick fasziniert vom politischen Washington. Viermal brach er das College ab, weil er lieber Kampagnen unterstützte. Um sich 1980 die Fahrt zum Parteitag der Demokraten zu finanzieren, gestaltete er eigene Wahlkampf-Buttons für Carter – aber auch für den Republikaner Reagan, da war er nicht zimperlich. Die verkaufte er dann an Unterstützer beider Lager. In einer einzigen Woche verdiente er damit über 12.000 Dollar – mehr als sein Jahresgehalt als Mitarbeiter im Kongressbüro. Was ihm zu denken gab. Er kündigte.
1989 eröffnete Warlick in Washington seinen ersten Laden für Politik-Souvenirs, fünf weitere folgten. Aus der spontanen Geschäftsidee wurde so ein kleines Imperium, selbst Präsidenten schauten bei ihm rein. "Bill Clinton kam oft vorbei", erzählt Warlick. "Einmal kaufte er alle meine Truman-Anstecker." In den Obama-Jahren wurde der Shop zum Ziel von Touristen aus aller Welt. "Barack war schon gut fürs Geschäft. Aber Michelle war noch besser."
Doch diese Zeiten sind vorbei.

Jim Warlick in seinem nachgebauten Oval Office neben dem Souvenirladen. Domenic Driessen/stern
Noch vor einem Jahr besuchten jeden Tag bis zu 3000 Menschen seinen Laden. Heute ist es nur noch ein Drittel. "Trump hat die Touristen vergrault", sagt Warlick. Vor allem die Kanadier würden fehlen. Seit die Nationalgarde auf den Straßen der Innenstadt patrouilliert, sei es noch stiller geworden. Im September brachen seine Einnahmen um die Hälfte ein. 14 von 41 Mitarbeitenden musste er inzwischen entlassen.
So wie Warlick geht es vielen anderen Laden- und Restaurantbesitzern in Downtown. Die Touristen bleiben aus, und viele Einheimische sparen nach dem langen Shutdown. Doch der Präsident selbst spielte die wirtschaftlichen Sorgen diese Woche erneut runter. Er erklärte, die hohen Preise seien nichts weiter als "eine Betrugsmasche der Demokraten".
Warlick kann darüber nur den Kopf schütteln. Er zeigt auf die hohen Zäune, die den Blick aufs Weiße Haus versperren, seit der Ostflügel abgerissen wurde, um Platz für Trumps neuen Ballroom zu schaffen. "Es ist tragisch", sagt er. "Da drin sitzt der größte Betrüger von allen." Dann senkt er die Stimme. "Wenn Sie für ein amerikanisches Medium schreiben würden – ich würde mich fast nicht mehr trauen, Ihnen das alles zu erzählen."
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Die Episode liegt mehr als 50 Jahre zurück – doch erst jetzt scheint sie aufgeklärt. Es geht um das wohl ikonischste Bild des Vietnamkriegs: Es zeigt ein von Napalm versehrtes Mädchen, das vor Schmerz schreiend auf einer Straße rennt. Seit der Veröffentlichung galt der Fotograf Nick Ut als Urheber des Fotos. Nun allerdings scheint klar: Es war wohl gar nicht Ut. Der amerikanische Fotograf Gary Knight hat die Hintergründe der Aufnahme in der auf Netflix zu sehenden Dokumentation "The Stringer" akribisch recherchiert – und erzählt in einem Essay für den stern, wer das Foto seinen Recherchen zufolge gemacht hat.

Einblick
Die Amerikaner reden mit den Russen, dann reden sie mit den Ukrainern, dann wieder mit den Russen – das Karussell der Friedensgespräche dreht sich alle Tage weiter. Mindestens so interessant wie die Verhandlungen sind die einzelnen Personen, die sich treffen – und ihre häufig nicht ganz uneigennützigen Interessen. Und die Europäer? Die haben derzeit überhaupt nichts zu sagen.

Ausblick
Was kommt nach Trump? Oder genauer: Wer kommt nach Trump? Zwei Männer aus dem sehr nahen Umfeld des Präsidenten beginnen, sich zu positionieren: Vizepräsident JD Vance und Außenminister Rubio. In der Öffentlichkeit versuchen beide, den Eindruck von Konkurrenz zu vermeiden – tatsächlich unterscheidet sich ihre Herangehensweise an Politik aber deutlich.
Fotofinish

AP Photo / Chris Carlson
Eigentlich sollte es bei der WM-Auslosung um Fußball gehen. Aber in Washington stand am Freitag mal wieder Donald Trump im Mittelpunkt. Der US-Präsident strahlte, als er von Gianni Infantino mit dem frisch erfundenen Fifa-Friedenspreis ausgezeichnet wurde – inklusive Medaille und einer goldenen Riesentrophäe. Der devot wirkende Fifa-Boss hofiert Trump nicht ohne Grund: Im kommenden Jahr steigt die WM in den USA, Kanada und Mexiko, und Trumps politische Launen könnten das Mammutturnier empfindlich treffen. Der Präsident, der schon lange auf den Friedensnobelpreis schielt, zeigte sich jedenfalls entzückt. "Das ist eine der größten Ehrungen meines Lebens", so Trump.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein müder Präsident und ein heißer Serientipp
Undankbare Zeiten
Liebe Leserinnen und Leser,
normalerweise ist das verlängerte Thanksgiving-Wochenende ein ruhiges in Washington. Die Stadt atmet durch, wenn Lobbyisten, Abgeordnete und Regierungsbeamte ihre Laptops gegen Truthahn und Familienfeste tauschen.
Auch Donald Trump hatte es eilig, die politischen Krisen – Stichwort Ukraine-Deal und Epstein-Akten – hinter sich zu lassen. Schon am Dienstagabend verließ der US-Präsident das Weiße Haus Richtung Mar-a-Lago, nachdem er traditionsgemäß zwei Truthähne begnadigt und die Demokraten beleidigt hatte.
Zurück bleibt eine alles andere als entspannte Hauptstadt an diesem Feiertagswochenende. Gerade mal zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt fielen am Mittwochnachmittag Schüsse. An der Metrostation Farragut West hatte ein 29-jähriger Afghane das Feuer auf zwei patrouillierende Soldaten der Nationalgarde eröffnet. Eines der Opfer, die 20-jährige Soldatin Sarah B., erlag tags darauf ihren Verletzungen. Ihr 24-jähriger Kamerad befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

Cathleen Dubois, eine pensionierte Krankenschwester, legt Blumen am Tatort vor der Metrostation Farragut West nieder. Craig Hudson / Reuters
Obwohl noch vieles unklar ist, nahm der Fall schnell eine politische Dimension an. Der mutmaßliche Schütze, der inzwischen in Haft sitzt, hatte einst für amerikanische Regierungsbehörden in Afghanistan gearbeitet, darunter die CIA. Im Jahr 2021 war er über "Operation Allies Welcome" in die USA eingereist – jenes Programm, mit dem die Biden-Regierung afghanischen Helfern nach der Machtübernahme der Taliban Schutz bot.
Seine Identität hat eine neue Debatte über Einwanderung ausgelöst. Und die MAGA-Welt in ihrer Sicht bestärkt, dass Massenabschiebungen für Amerikas Sicherheit unerlässlich sind.
Trump selbst bezeichnete die Tat in einer TV-Ansprache als Terrorakt. Er versprach, der Schütze werde "einen sehr hohen Preis zahlen", und kündigte an, 500 zusätzliche Soldaten nach Washington zu entsenden. Noch brisanter: Der Präsident will die Abschiebungen verdoppeln, insbesondere von Afghanen, die über das Biden-Programm ins Land kamen. Zudem ließ das Weiße Haus verkünden, man werde sämtliche von der Vorgängerregierung genehmigten Asylfälle neu prüfen.
Während im politischen Washington die Schuldzuweisungen kursieren, bleibt ein Detail ungehört: Die getötete Soldatin war an diesem Tag freiwillig im Einsatz – um anderen Kollegen zu ermöglichen, Thanksgiving mit ihrer Familie zu verbringen.
Seine Identität hat eine neue Debatte über Einwanderung ausgelöst. Und die MAGA-Welt in ihrer Sicht bestärkt, dass Massenabschiebungen für Amerikas Sicherheit unerlässlich sind.
Trump selbst bezeichnete die Tat in einer TV-Ansprache als Terrorakt. Er versprach, der Schütze werde "einen sehr hohen Preis zahlen", und kündigte an, 500 zusätzliche Soldaten nach Washington zu entsenden. Noch brisanter: Der Präsident will die Abschiebungen verdoppeln, insbesondere von Afghanen, die über das Biden-Programm ins Land kamen. Zudem ließ das Weiße Haus verkünden, man werde sämtliche von der Vorgängerregierung genehmigten Asylfälle neu prüfen.
Während im politischen Washington die Schuldzuweisungen kursieren, bleibt ein Detail ungehört: Die getötete Soldatin war an diesem Tag freiwillig im Einsatz – um anderen Kollegen zu ermöglichen, Thanksgiving mit ihrer Familie zu verbringen.
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Ein TV-Tipp für die kalten Tage: Auf dem Streaming-Dienst Paramount+ (bei uns auch über Amazon Prime verfügbar) ist vor einigen Tagen die zweite Staffel von "Landman" angelaufen. Serienschöpfer Taylor Sheridan, der auch das "Yellowstone"-Universum geschaffen hat, zeigt darin, wie Tommy Norris, der von einem überragenden Billy Bob Thornton gespielt wird, ein Öl-Unternehmen in die Zukunft führt. Die Serie strotzt nur so vor Sexismus und politisch unkorrekten Sprüchen, erzählt aber viel über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft. Der Trailer zur Serie gibt einen Vorgeschmack.

Einblick
Donald Trump hat Blutergüsse an Händen und Beinen, er spricht über eine aufwendige MRT-Untersuchung, nimmt erst ab der Mittagszeit öffentliche Termine wahr und sinniert vor Journalisten über das Leben nach dem Tod. Der Gesundheitszustand des 79-Jährigen beschäftigt die Vereinigten Staaten. Hält er seine zweite Amtszeit überhaupt durch? Mein Kollege Marc Etzold erklärt, was wir über Trumps physische Verfasstheit wissen (+) – und warum das Thema derzeit so hochkocht.

Ausblick
"Über Land ist es einfacher, aber das wird sehr bald losgehen", sagte Trump am Donnerstag in einem Erntedankfest-Telefonat mit Mitgliedern des US-Militärs. Gemeint waren damit Angriffe auf Venezuela, gegen deren Drogenkartelle die US-Regierung offiziell bereits auf See vorgeht. Das wahre Ziel dürfte allerdings Diktator Nicolás Maduro sein, der vergangene Woche Waffen an loyale Milizen verteilen ließ. Mein Kollege Andrzej Rybak hat mit Venezolanern über die Angst vor einer US-Invasion gesprochen – und über eine Zukunft, die auch ohne Maduro nicht automatisch eine bessere wäre.
Es war einmal in Amerika

AP Photo
Während die Bilder der Brandkatastrophe in Hongkong diese Woche um die Welt gingen, jährte sich in den USA eines der tödlichsten Infernos in der Geschichte des Landes. 492 Menschen kamen am 28. November 1942 ums Leben, als der Nachtclub "Cocoanut Grove" in Boston Feuer fing. Verschlossene Notausgänge, leicht entflammbare Dekoration, nur eine Drehtür als Eingang und zweimal so viele Gäste wie vorgesehen – der auch bei Stars beliebte Club missachtete an diesem verhängnisvollen Samstag sämtliche Sicherheitsvorkehrungen. Dass nicht noch mehr der knapp 1000 Besucher starben, lag vor allem an den gut ausgestatteten Krankenhäusern der Umgebung, die nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg auf Großeinsätze vorbereitet worden waren. Der letzte noch lebende Augenzeuge des Feuers, Bob Shumway, starb im Juni dieses Jahres im Alter von 101 Jahren.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: ein Plan für Frieden in der Ukraine und ein möglicher Krieg in Venezuela
Die erste große Niederlage des Donald Trump
Liebe Leserinnen und Leser,
seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus umgab Donald Trump ein Mythos der Unantastbarkeit. Doch in dieser Woche bekam die Fassade erste Risse.
Ausgerechnet ein Gesetz, das Trump um jeden Preis verhindern wollte, ging mit nur einer Gegenstimme durch den republikanisch kontrollierten Kongress. Das Justizministerium muss nun die lange unter Verschluss gehaltenen Akten rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlichen. Noch vor einer Woche hätte darauf niemand gewettet – auch nicht Lisa Phillips.
Die heute 47-Jährige wurde als junges Model von Epstein auf seiner Insel missbraucht (+). Heute kämpft sie gemeinsam mit ihren "Survivor Sisters“ für Gerechtigkeit und die Strafverfolgung von Epsteins Mittätern.
Auf einer Pressekonferenz kurz vor der Abstimmung am Dienstag hatten Phillips und andere Frauen den Abgeordneten noch ins Gewissen geredet. Nach dem fast einstimmigen Ergebnis, sei sie "überwältigt" gewesen, erzählte mir Phillips später. "In diesem Moment wurden wir Zeugen eines Durchbruchs, für den wir jahrelang gekämpft haben."

Lisa Phillips, 47, umringt von ihren „Survivor Sisters“ bei einer Pressekonferenz am Dienstag vor dem US-Kapitol
. Heather Diehl / Getty
Was Epstein-Opfer wie Phillips als "Moment des Triumphes" empfinden, ist für Trump die bisher größte Niederlage seiner zweiten Amtszeit. Am Mittwoch musste er seinen eigenen Namen unter ein Gesetz setzen, das ihn politisch verwundbar macht. Denn die Freigabe der Akten ist mehr als ein juristischer Vorgang. Sie zeigt, dass Trumps Macht nicht grenzenlos ist und dass selbst loyale Republikaner sich ihm widersetzen – wenn der Druck der öffentlichen Meinung zu groß ist.
Das heißt allerdings noch lange nicht, dass nun alle Epstein-Akten ans Licht kommen (+). Das Gesetz enthält viele Schlupflöcher, darunter eine Ausnahme für Dokumente, die in laufenden Ermittlungen benötigt werden. Und eine solche Ermittlung hat Trump gerade gegen prominente Demokraten angestoßen.
Das heißt allerdings noch lange nicht, dass nun alle Epstein-Akten ans Licht kommen (+). Das Gesetz enthält viele Schlupflöcher, darunter eine Ausnahme für Dokumente, die in laufenden Ermittlungen benötigt werden. Und eine solche Ermittlung hat Trump gerade gegen prominente Demokraten angestoßen.
Phillips weiß, dass ihr Kampf für Gerechtigkeit nicht zu Ende ist. Sie befürchtet, dass die Namen mächtiger Männer trotz des Gesetzes geschützt werden könnten. "Wir werden wachsam bleiben", sagte sie mir. "Und wir werden nicht zulassen, dass unsere Wahrheit erneut verschleiert wird."
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Am Wochenende treffen sich die G20-Staaten im südafrikanischen Johannesburg – nicht dabei ist allerdings US-Präsident Donald Trump. Er boykottiert den Gipfel, weil Südafrika seiner Meinung nach nichts gegen einen angeblichen „Völkermord“ an weißen Südafrikanern unternehme. Trumps Hass auf das Land am Kap ist bekannt – interessant ist allerdings, wie seine Politik an die langjährige Kooperation der USA mit dem rassistischen Apartheidsregime anknüpft. (+)

Einblick
Amerikanische und russische Unterhändler legten am Donnerstag einen 28-Punkte-Plan vor, der zu einem Frieden in der Ukraine führen soll – der allerdings ein paar große Fragen aufwirft, allen voran: Wäre das nicht eine Kapitulation der Ukraine? Mein Kollege Moritz Gathmann, der immer wieder aus der Ukraine berichtet, hat dazu eine klare Meinung (+): Wir können uns über den Plan aufregen, aber er spiegelt eben die militärische Lage wider. Und Europa hat es in den vergangenen drei Jahren versäumt, daran etwas zu ändern.

Ausblick
Donald Trump rüstet seit Wochen massiv gegen Venezuela auf. In Washington wächst die Sorge, dass die Lage eskalieren könnte. Doch wie nah sind die USA wirklich an einem Krieg? Lateinamerika-Experte Benjamin Gedan gibt im Gespräch eine sehr klare Einschätzung – nach einer friedlichen Lösung sieht es demnach kaum aus. (+)
Fotofinish

AMPAS/Avalon/actionpress
Nein, Sie haben nichts verpasst. Die Academy Awards werden weiterhin Ende Februar oder Anfang März vergeben. Aber ja, das ist Tom Cruise mit einem Oscar. Seit 2009 werden die Preise fürs Lebenswerk nicht mehr während der Live-Zeremonie verliehen, sondern im Rahmen einer eigenen Veranstaltung, den Governors Awards. Viermal war der 63-Jährige für den wichtigsten Preis im Showbusiness nominiert, gewonnen hat er ihn nie. Cruise schien über die Auszeichnung ohne Konkurrenz aber nicht minder gerührt. Am Ende seiner knapp zehnminütigen Rede bat er alle Anwesenden im Saal, die je mit ihm gearbeitet hatten, aufzustehen. Man kann sich bei dieser Karriere, die von "Rain Man" bis zur "Mission Impossible"-Reihe reicht, vorstellen: Es standen sehr viele.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: Neue Epstein-Mails und ein Prinzenbesuch
Die wahren Krisenmanager
Liebe Leserinnen und Leser,
der längste Shutdown der US-Geschichte ist vorbei – und Millionen Amerikaner atmen auf. Seit dem 1. Oktober arbeiteten Bundesangestellte ohne Lohn oder wurden in den Zwangsurlaub geschickt, Flughäfen strichen Tausende Flüge, weil Personal fehlte, und Familien warteten vergebens auf ihre Lebensmittelmarken.
Auch Marvin G. war betroffen. Der 35-Jährige arbeitet im Heimatschutzministerium, im Shutdown hat er zweieinhalb Gehaltsschecks verpasst. "Die letzten Wochen waren emotional extrem belastend", sagte mir Marvin, als er wie jeden Mittag in der Schlange vor einer Essensausgabe nahe dem Kapitol wartete. Seinen Nachnamen will er lieber nicht nennen. Je länger der Stillstand dauerte, desto schneller schrumpften seine Rücklagen. Für die Miete musste er einen Bankkredit aufnehmen. Marvin ist froh, dass der Stillstand vorbei ist. "Die Demokraten haben ihren Punkt klargemacht", sagt er. "Mehr wäre nicht drin gewesen." Was er damit meint, lesen Sie hier(+).
Normalerweise ist die "World Central Kitchen" in Katastrophengebieten im Einsatz. Doch als klar wurde, dass dieser Shutdown länger anhalten würde, eröffnete die Hilfsorganisation zwei Essensausgaben mitten in der Hauptstadt. Koordinator Daniel Baler, 28, verteilte dort seit Mitte Oktober Lunchboxen, Obst und heißen Kaffee – 4000 bis 5000 Mahlzeiten täglich.

Daniel Baler, 28, war schon bei Erdbeben und Überflutungen im Einsatz. "Das hier ist etwas anderes", sagt er. privat
Ursprünglich sollten vor allem Staatsbedienstete versorgt werden. Als die Trump-Regierung jedoch die Notfallfinanzierung für SNAP, das wichtigste Lebensmittelhilfeprogramm, strich, kamen immer mehr Leute, berichtet Baler. Auch er ist erleichtert über das Shutdown-Ende. "Wir wären bald an unsere Grenzen gekommen."
Die Szenen von langen Schlangen vor Essensausgaben und Tafeln im ganzen Land standen im deutlichen Kontrast zu den Bildern, die das Weiße Haus in den vergangenen Wochen produzierte.
Während frühere Präsidenten sich in Shutdown-Zeiten in Krisenräumen verschanzten, um Lösungen zu verhandeln, absolvierte Donald Trump eine Art Parallelprogramm. Er besuchte sechs Länder, ließ den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen, richtete millionenschwere Dinner für Großspender aus und verbrachte acht Nachmittage auf dem Golfplatz. Am Vorabend des geplanten SNAP-Stopps feierte Trump in Mar-a-Lago eine glamouröse Halloween-Party à la "Great Gatsby".
Ein schwieriges Bild von dem Mann, der vor einem Jahr die Wahl mit dem Versprechen gewonnen hatte, "für die kleinen Leute" zu kämpfen.
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Niemand sorgt in Washington derzeit für mehr Verwirrung als Marjorie Taylor Greene. Einst war sie Trumps loyalste Kämpferin im Kongress, eine Frontfrau der MAGA-Bewegung, die jeden Zweifel an ihrem Idol erstickte. Doch seit einigen Monaten wirkt Greene wie ausgewechselt und schlägt sich nun bei Themen von Gesundheitsversorgung bis Gaza aufseiten der Demokraten. Ihre Wandlung irritiert Verbündete wie Gegner gleichermaßen – allen voran den Präsidenten (+).

Einblick
Kaum ist der Shutdown vorbei, holt Donald Trump eine andere Krise wieder ein: der Skandal um seinen alten Freund Jeffrey Epstein. Neu veröffentlichte E-Mails aus Epsteins Nachlass legen nahe, dass der Präsident mehr gewusst haben könnte, als er bislang zugibt (+). In einer Mail bezeichnet Epstein Trump als "Hund, der nicht gebellt hat". Im Kongress rückt derweil eine Abstimmung über die Freigabe der Ermittlungsakten näher – ein Votum, das Trump mit aller Macht zu verhindern sucht.

Ausblick
Kommenden Dienstag empfängt Donald Trump den saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman im Weißen Haus. Der Besuch wird in Washington mit Spannung erwartet. Auf der Agenda stehen die Lage in Gaza und ein Ausbau der strategischen Partnerschaft. Mein Kollege Steffen Gassel hat vorab mit Bernard Haykel, einem Vertrauten des Kronprinzen, über die höchst erstaunliche Bromance der beiden Führungsfiguren gesprochen (+).
Es war einmal in Amerika

Foto: George Nikitin/AP
Man muss zweimal hinschauen, um das Bild zu verstehen. Warum endet die Straße vor dem Polizisten hier so abrupt – und warum ragt das nächste Segment schräg gen Himmel? Schuld ist das sogenannte Loma-Prieta-Erdbeben, das San Francisco und Umgebung vor knapp 25 Jahren, am 17. Oktober 1989, heimsuchte. 63 Menschen kamen damals ums Leben, mehr als 3700 wurden verletzt – auch auf den Highways, die, wie hier der Bay-Bridge-Highway in San Francisco, wie Kartenhäuser kollabierten. Die Reparaturen fanden in Rekordgeschwindigkeit statt: Nur einen Monat später, am 18. November, wurde die Oakland-Bay-Bridge wieder für den Verkehr freigegeben. In Kalifornien driften zwei Kontinentalplatten aneinander vorbei und verhaken sich. Wenn sich die Spannungen plötzlich lösen, kommt es zu Erdbeben.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Die Demokraten können noch siegen
Liebe Leserinnen und Leser,
am Dienstagabend war ich auf einer Wahlparty im New Yorker Stadtteil Queens, als ein ohrenbetäubender Lärm losbrach. Plötzlich schrien alle wie verrückt: "Zohran, Zohran". New York hatte in diesem Moment Geschichte geschrieben und den 34-jährigen Zohran Mamdani zum ersten, wie er sich selbst nennt, demokratisch-sozialistischen Bürgermeister gewählt. Doch nicht nur in New York war es ein guter Abend für die Demokraten. Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey gewannen die Demokratinnen Abigail Spanberger und Mikie Sherrill souverän. Und in Kalifornien stimmten Wähler für eine demokratische Volksinitiative zur Neugestaltung der Wahlkreise – ein Sieg, der Kaliforniens Gouverneur ein Sprungbrett für eine Präsidentschaftskandidatur liefert (+).
Fast genau ein Jahr nach Donald Trumps Triumph bei der Präsidentschaftswahl zeigt sich: Die demokratische Partei kann noch gewinnen. Indem sie starke Kandidaten aufstellt. Die Lebenshaltungskosten ins Zentrum ihres Wahlkampfs rückt. Und immer und immer wieder Trumps unbeliebteste Maßnahmen attackiert.
Trotzdem stehen die Demokraten weiter vor einer Richtungsfrage (+): Sind sie als moderatere Partei nach dem Vorbild von Sherrill und Spanberger erfolgreicher – oder ist die Partei mit einer linkspopulistischen Vision wie der von Mamdani besser positioniert?

Kevin Montalvo, 32, hat für Zohran Mamdani Haustürwahlkampf gemacht – mit einer sehr klaren Botschaft: "billigere Lebensmittel". Leonie Scheuble
Auf der Wahlparty in Queens ist die Richtung für Kevin Montalvo klar. Die Demokraten sollten aus New York lernen und auf jüngere, progressivere Kandidaten setzen, sagt der 32-jährige Lehrer aus der Bronx. "Die Leute lechzen nach Wandel."
Prominente Parteispitzen sehen das anders. Es sei Zeit für eine neue demokratische Ära, die sowohl Mamdanis progressive Mitstreiter als auch etablierte Demokraten einbezieht. "Big Tent Politics" nennen sie das – quasi alle Strömungen unter einem Zelt vereint, vom linken Flügel bis zur Mitte. Doch in vielen Staaten deuten sich bereits erbitterte Vorwahlkämpfe an, in denen sich progressive und etablierte Demokraten gegenüberstehen. Früher oder später, warnen politische Beobachter, wird sich die Partei also entscheiden müssen, mit welcher Wahlstrategie sie in die kommenden Zwischenwahlen zieht.
In New York scheint die Antwort für den Moment klar (+). "Heute Abend habt ihr ein Mandat für Veränderung geliefert", rief Mamdani am Dienstagabend seinen jubelnden Anhängern zu. "Ein Mandat für eine neue Art von Politik."
Prominente Parteispitzen sehen das anders. Es sei Zeit für eine neue demokratische Ära, die sowohl Mamdanis progressive Mitstreiter als auch etablierte Demokraten einbezieht. "Big Tent Politics" nennen sie das – quasi alle Strömungen unter einem Zelt vereint, vom linken Flügel bis zur Mitte. Doch in vielen Staaten deuten sich bereits erbitterte Vorwahlkämpfe an, in denen sich progressive und etablierte Demokraten gegenüberstehen. Früher oder später, warnen politische Beobachter, wird sich die Partei also entscheiden müssen, mit welcher Wahlstrategie sie in die kommenden Zwischenwahlen zieht.
In New York scheint die Antwort für den Moment klar (+). "Heute Abend habt ihr ein Mandat für Veränderung geliefert", rief Mamdani am Dienstagabend seinen jubelnden Anhängern zu. "Ein Mandat für eine neue Art von Politik."
Take care
Leonie Scheuble
aus New York City
aus New York City

Rückblick
Sie ist so etwas wie die große alte Dame der amerikanischen Politik: Nancy Pelosi. Nun hat die 85-Jährige verkündet, nach fast 40 Jahren im Repräsentantenhaus Anfang 2027 abzutreten. Mich hat Pelosi immer beeindruckt, sie war eine gewiefte Taktikerin. Und sie hat in vielen Bereichen oft als Erste die gläserne Decke durchstoßen (+), damit auch häufig den Weg für Frauen geöffnet, die ihr nachfolgten.

Einblick
Ein Spoiler: Hier geht es heute einmal nicht um Politik, sondern um etwas Existenzielleres – den Tod. Meine Kollegin Alexandra Kraft hat in North Carolina einen Mann getroffen, der sich damit so gut auskennt wie nur wenige. Seit 30 Jahren begleitet Scott Janssen Menschen beim Sterben. Und er, der anfangs mit Spiritualität überhaupt nichts anfangen konnte, hat dabei erstaunliche Erfahrungen gemacht (+).

Ausblick
In den USA hat es einen Putsch gegeben – durch die Tech-Konzerne im Silicon Valley. Davon ist die niederländische Tech-Expertin und frühere Europaabgeordnete Marietje Schaake überzeugt. Mein Kollege Marc Etzold hat sie in Amsterdam getroffen (+). Im Interview warnt Schaake vor einer "Umverteilung der Macht" und einer "symbiotischen Beziehung" zwischen den Konzernen und Donald Trump.
Fotofinish

Auto an Auto, dicht an dicht – Hunderte haben sich hier in Austin, Texas, in lange Schlangen eingereiht. Die Menschen warten in den Wagen, um verbilligte Lebensmittel einzukaufen – jeder achte Amerikaner ist darauf angewiesen. Trumps Regierung wollte das Programm der sogenannten Food stamps wegen des Regierungsstillstands aussetzen, wurde aber nun von einem Gericht dazu verurteilt, die Hilfen weiter zu leisten. "16 Millionen Kinder sind in Gefahr, Hunger leiden zu müssen", sagte Richter John McConnell in seiner Begründung.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit dabei: Obamas neues Buch und ein Gipfel mit Sprengstoff
Der neue Anti-Trump
Liebe Leserinnen und Leser,
am 4. November wählt New York einen neuen Bürgermeister. Und bei einer elektrisierenden Wahlkampfveranstaltung in einem vollgepackten Stadion in Queens am vergangenen Sonntag verstand ich, wieso der Favorit Zohran Mamdani heißt. Nach linken Ikonen wie Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders war es dieser 34-jährige Abgeordnete, der die Menge zum Beben brachte. Ein Sohn ugandisch-indischer Einwanderer, geboren in Kampala, ein bekennender Muslim, ein politisches Ausnahmetalent, das verkörpert, was viele längst verloren glaubten: die Idee, dass jeder es schaffen kann in dieser Stadt, in diesem Land.
Sanders nannte ihn "Trumps schlimmsten Albtraum". Mamdani selbst rief: "Während Donald Trumps Milliardäre glauben, sie könnten sich diese Wahl kaufen, haben wir eine Bewegung der Massen." Die Menge jubelte.
Noch vor einem Jahr kannte den demokratisch-sozialistischen Abgeordneten kaum jemand. Heute gilt Mamdani, den manche bereits mit Barack Obama vergleichen, als Shootingstar der amerikanischen Linken. Mit Humor und einem unermüdlichen Fokus auf seine Kernbotschaft, New York erschwinglicher zu machen, hat Mamdani soziale Medien und Wählerherzen erobert. Mal erklärt er Inflation aus einem typischen New Yorker Foodtruck, mal springt er im Anzug ins eiskalte Wasser von Coney Island – als Symbol für sein Versprechen, die Mieten einzufrieren.

Die "Hot Girls for Zohran" Gianna Shaw (l.) und Hailey Bennet. Foto privat
Seine Kampagne lebt von der Basis. Tausende Freiwillige, die für ihn in allen fünf Bezirken Haustürwahlkampf machen. Ihr Einsatz machte Mamdani zum Überraschungssieger der Vorwahlen – gegen den Favoriten und früheren Gouverneur Andrew Cuomo. Auch die Freundinnen Gianna Shaw, 27 und Hailey Bennet, 29, haben bereits für Mamdani an fremde Türen geklopft. "Er hat echte Pläne. Wird er alles umsetzen können? Vermutlich nicht. Aber es wird Zeit, dass sich was ändert", sagt Gianna. "Und wir brauchen jemanden, der nicht vor Trump kuscht", ergänzt Hailey.
Der Präsident selbst nennt Mamdani einen "kommunistischen Irren". Er hat angedeutet, ihn abschieben lassen zu wollen. Und er drohte bereits, die Nationalgarde nach New York zu schicken.
Mamdani lässt sich davon nicht beeindrucken. Sein alter Schulfreund Philip Sidiroglou, den ich für ein Porträt des aufstrebenden Demokraten in New York traf (+) und der bis heute nur ein paar Straßen von Mamdani entfernt wohnt, vergleicht ihn in puncto Charisma und Kommunikationstalent ausgerechnet mit Ronald Reagan. Gewinnt Mamdani am kommenden Dienstag, worauf alle Umfragen hindeuten, beginnt die eigentliche Arbeit: die größte Stadt Amerikas zu regieren – und den Demokraten zu beweisen, dass man mit linker Politik gegen Trump erfolgreich sein kann.
Es wäre ein politisches Märchen. Eines, wie es wohl nur New York schreiben kann.
Mamdani lässt sich davon nicht beeindrucken. Sein alter Schulfreund Philip Sidiroglou, den ich für ein Porträt des aufstrebenden Demokraten in New York traf (+) und der bis heute nur ein paar Straßen von Mamdani entfernt wohnt, vergleicht ihn in puncto Charisma und Kommunikationstalent ausgerechnet mit Ronald Reagan. Gewinnt Mamdani am kommenden Dienstag, worauf alle Umfragen hindeuten, beginnt die eigentliche Arbeit: die größte Stadt Amerikas zu regieren – und den Demokraten zu beweisen, dass man mit linker Politik gegen Trump erfolgreich sein kann.
Es wäre ein politisches Märchen. Eines, wie es wohl nur New York schreiben kann.
Take care
Leonie Scheuble
aus New York City
aus New York City

Rückblick
Eigentlich wollte Donald Trump seine große Asienreise mit einem neuen Handelsabkommen mit Chinas Präsident Xi Jinping abrunden. Stattdessen alarmierte er die Welt kurz vor dem Treffen mit der Nachricht, die USA würden ihre Atomwaffentests wiederaufnehmen (+), schreibt meine Kollegin Bettina Sengling. Trump fällt damit auf eine klassische Provokation Putins herein. Das sollte uns allen Sorge bereiten (+).

Einblick
Als First Lady scheute Michelle Obama oft das Gespräch über ihre Outfits. Zu Gast bei "ABC News" sprach sie nun ausführlich über die Absicht hinter ihren Modeentscheidungen im Weißen Haus. Ihr neues Buch "The Look" zeigt über 200 bislang unveröffentlichte Bilder und beleuchtet, wie Kleidung für Obama ein Mittel war, um Vielfalt und Inklusion zu fördern – etwa durch die Wahl junger, weiblicher Designerinnen.

Ausblick
Die Zahl klingt unglaublich: Knapp 42 Millionen Amerikaner, also in etwa jeder achte Einwohner, sind auf Unterstützung des Supplemental Nutrition Assistance Programs, kurz SNAP, angewiesen. Staatliche Lebensmittelmarken helfen vielen Menschen in den USA, die sich nicht ausreichend selbst versorgen können. Aufgrund des andauernden Shutdowns läuft am Samstag die Finanzierung für SNAP aus. Private Tafeln sind jetzt schon überfordert von dem Ansturm. Welch verheerende Auswirkungen dies haben wird, erklärt die neueste Folge des "NPR Politics"-Podcasts anschaulich.
Es war einmal in Amerika

PhotoQuest/Getty Images
Der Wagen sieht aus wie eine Kutsche auf Rädern – aber letztendlich ist die New Yorker U-Bahn ja auch genau das. Am 27. Oktober 1904 eröffnete der damalige Bürgermeister George McClellan mit der Jungfernfahrt den ersten Streckenabschnitt der heute berühmt-berüchtigten Subway – vom Rathaus in Lower Manhattan über 28 Stationen bis nach Harlem. Heute hat das U-Bahnsystem der Stadt 472 Haltestellen – Rekord. Es ist zwar nicht das älteste, aber das erste vollelektrisch betriebene der Welt. Und auch, wenn die Einwohner ununterbrochen über marode Schienen und dreckige Züge schimpfen: Ohne die Subway wäre New York nicht zum "Big Apple" geworden.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Mit der Abrissbirne durchs Weiße Haus
Liebe Leserinnen und Leser,
es war ein sonniger Herbstmittag, als ich diese Woche Richtung Weißes Haus spazierte, um mir Donald Trumps neuestes Bauprojekt anzusehen. Ich hörte das Dröhnen der Maschinen, bevor ich sie sah. Während vor dem Gebäude eine Schulklasse für Fotos posierte, konnte man durch den Zaun zwei Bagger bei der Arbeit erspähen. Sie waren gerade dabei, die Reste des einstigen Ostflügels abzureißen, um Platz für einen gigantischen Ballsaal zu schaffen.
Trump träumt schon lange davon. Das Weiße Haus war ihm bereits in der ersten Amtszeit zu klein für Staatsbankette und Empfänge. Nun soll auf dem Gelände des East Wing ein neuer Prunksaal entstehen: rund 8000 Quadratmeter groß, mit Platz für bis zu eintausend Gäste. "Ich erweise diesem Ort eine Ehre", verkündete Trump Anfang der Woche, als die ersten Bagger anrückten.
Historiker und Demokraten sehen das anders. Für sie sind die Bilder der Abrissarbeiten ein Symbol dafür, wie Trump das "People’s House" für seine persönliche Agenda missbraucht.
"Er reißt buchstäblich Geschichte ab", sagte mir James Gordon, ein junger Mann auf Dienstreise aus Chicago, der ebenfalls versuchte, einen Blick auf die Baustelle zu erhaschen. "Es zeigt, dass er vor nichts mehr zurückschreckt."

Blick auf die traurigen Überreste des East Wing an der Ostflanke des Weißen Hauses. Andrew Leyden/Reuters
Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Trump keine Zeit verschwendet, dem Weißen Haus seinen Stempel aufzudrücken. Erst ließ er das Oval Office vergolden. Dann pflasterte er den Rasen des berühmten Rosengartens, damit er aussieht wie in Mar-a-Lago. Nun also der Ballsaal, dessen Kosten sich auf geschätzte 300 Millionen Dollar belaufen sollen.
"Er ist der Präsident, das ist sein gutes Recht", meint Linda, ihren Nachnamen will sie nicht nennen. Die 51-Jährige ist mit Mann und Sohn aus Montana angereist und steht zum ersten Mal vorm Weißen Haus. "Und Trump bezahlt es ja selbst."
Tatsächlich soll der Erweiterungsbau vollständig von privaten Geldgebern finanziert werden – darunter Tech-Riesen wie Apple, Google und Amazon. Was sie sich davon versprechen, darüber schweigt die Regierung. Mein Kollege Marc Etzold sieht durch diesen Deal viel mehr beschädigt als nur den Amtssitz des US-Präsidenten (+).
Und Trump ist mit seinen Bauplänen längst nicht fertig. Erst letzte Woche kündigte er an, in Washington einen Triumphbogen wie in Paris zu errichten. Der bescheidene Name: "Arc de Trump".
Tatsächlich soll der Erweiterungsbau vollständig von privaten Geldgebern finanziert werden – darunter Tech-Riesen wie Apple, Google und Amazon. Was sie sich davon versprechen, darüber schweigt die Regierung. Mein Kollege Marc Etzold sieht durch diesen Deal viel mehr beschädigt als nur den Amtssitz des US-Präsidenten (+).
Und Trump ist mit seinen Bauplänen längst nicht fertig. Erst letzte Woche kündigte er an, in Washington einen Triumphbogen wie in Paris zu errichten. Der bescheidene Name: "Arc de Trump".
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
aus Washington, D.C.

Rückblick
Verdeckte Kameras, Hightech-Kontaktlinsen, Röntgentische, manipulierte Kartenmischgeräte: Die Utensilien, die das FBI am Donnerstag bei einer Pressekonferenz präsentierte, hätten aus dem Drehbuch von "Ocean's Eleven" stammen können. Über Jahre hinweg sollen Mitglieder der Cosa Nostra sie in illegalen Pokerspielen benutzt und Spieler so um Millionen US-Dollar betrogen haben – wohl unter Mitwirkung bekannter Namen der amerikanischen Basketballliga NBA, darunter Chauncey Billups, Cheftrainer der Portland Trail Blazers. Mehrere Dutzend Menschen wurden festgenommen. Der Skandal vermiest vielen Fans die neue NBA-Saison, die erst diese Woche begonnen hat.

Einblick
Der Skandal um Jeffrey Epstein zieht auch sechs Jahre nach seinem Tod immer weitere Kreise – von der Downing Street bis ins Weiße Haus, wie unsere Großbritannien-Korrespondentin Dagmar Seeland und ich in einem großen stern-Report rekonstruiert haben (+). Die posthum diese Woche erschienenen Memoiren von Virginia Giuffre – dem prominentesten Opfer Epsteins – bringen neue drastische Details ans Licht und zeichnen das Bild eines bizarr-sexsüchtigen Netzwerks mächtiger Männer (+). Auch Lisa Phillips gehörte zu Epsteins Opfern. Im Gespräch erzählte mir das frühere Model von einem Inselausflug, der im Albtraum endete, und warum sie heute anderen Frauen hilft (+).

Ausblick
Seit Anfang September hat die Trump-Regierung acht Boote vor der Küste Venezuelas angegriffen und dabei mindestens 34 Menschen getötet. Während der Präsident von einem Kampf gegen Drogenkartelle spricht, lässt er gleichzeitig Truppen im Karibischen Meer aufrüsten und bestätigte Berichte über verdeckte CIA-Operationen in Venezuela. All dies schürt in Washington Spekulationen, dass Trumps wahres Ziel ein anderes ist: der Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (+).
Fotofinish

Mike Blake/Reuters
Nicht mal als Hund kann man heutzutage in Amerika noch unpolitisch sein: Buddy, Penny und Honey (v. l.) – so wollen es zumindest ihre Besitzer interpretiert wissen – bellen am Tor ihres Hauses in Encinitas (US-Staat Kalifornien) für Zollfreiheit und Demokratie. Donald Trump wird sich also eher fernhalten. Glück für die drei Bewacher: Die Postzustellung ist vom mittlerweile zweitlängsten Shutdown der US-Geschichte nicht betroffen. Es bleiben somit noch die Waden der Postboten, um sich abzureagieren.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Unterwegs in einem lahmgelegten Land
Liebe Leserinnen und Leser,
das Erste, was ich im Urlaub tue, ist, die Eilmeldungen auf dem Handy auszustellen. Doch als ich vor wenigen Tagen am Eingang des wunderbaren Acadia Nationalparks in Maine stand, wusste ich auch ohne Push-Nachrichten, was die geschlossenen Kassenhäuschen zu bedeuten hatten: Amerika ist mal wieder im Shutdown.
Seit Monatsbeginn steht ein großer Teil von Donald Trumps Regierung still. Der Kongress hat es nicht geschafft, einen neuen Staatshaushalt zu verabschieden – das Land läuft im Notbetrieb.
Die Auswirkungen sind bereits überall spürbar: Viele Nationalparks, staatliche Museen und Zoos haben dichtgemacht. Oder, so erlebte ich es, lassen einfach die Kassen unbesetzt, und man kann umsonst rein. An den Flughäfen kommt es zu langen Verzögerungen, weil das Sicherheitspersonal fehlt. Menschen warten vergeblich auf ihre Bundeskredite. Und Forschungsinstitute und Lebensmitteltafeln bangen um ihre Reserven. Am härtesten trifft es jedoch die mehreren Hunderttausend Staatsangestellten, die seit September kein Gehalt mehr bekommen.

Für diesen Ausblick im Acadia-Nationalpark hätte ich auch 35 US-Dollar Eintritt gezahlt – im Shutdown war es umsonst. privat
Während viele also nicht wissen, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen, scheint der Kongress lahmgelegt, man kann sich nicht einigen. Hauptstreitpunkt ist die Frage, wie viel Amerikaner für ihre Krankenversicherung bezahlen sollen. Die Demokraten fordern eine Verlängerung der staatlichen Obamacare-Zuschüsse, auf die mehr als zehn Millionen Menschen angewiesen sind. Die Republikaner wollen diese streichen, brauchen dafür jedoch demokratische Stimmen. Je länger der Shutdown andauert, desto gereizter wird der Ton. Beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig, das Land in Geiselhaft zu nehmen. Nur der Präsident scheint bester Laune.
Beflügelt von seinem Triumph in Nahost, von den Fortschritten, so deutet es Trump zumindest, in der Ukraine, wo demnächst wohl ein erneuter Gipfel mit Putin ansteht, nutzt er den Stillstand als Chance, den Regierungsapparat weiter tatkräftig einzustampfen. Bisher hat er mehr als 4000 Staatsbedienstete gefeuert, Tausende weitere sollen folgen. "Wir legen gerade erst los", droht er.
Es dürfte ein langer Stillstand werden.
Take care
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.

Rückblick
Wie genau kam es eigentlich zum Deal in Gaza? Eine wichtige Rolle spielte ein Mann, den kaum jemand kennt: Bishara Bahbah überbrachte Hamas-Botschaften nach Washington und umgekehrt. Mein Kollege Fabian Huber hat mit ihm über sein Dasein im Schatten gesprochen. (+)

Einblick
In den USA sorgen derzeit geleakte Chats junger Republikaner für Aufsehen. Die US-Zeitung "Politico" hat Tausende private Nachrichten enthüllt, in denen junge Führungskräfte aus Trumps Partei Witze über Gaskammern, Sklaverei und Vergewaltigung machen. Sie bezeichneten Schwarze als Affen, fantasierten darüber, ihre politischen Gegner in Gaskammern zu stecken, und teilten Sprüche wie "Ich liebe Hitler". Während Vizepräsident J. D. Vance den Skandal verharmlost, mehren sich die Rücktrittsforderungen.

Ausblick
Unter dem Motto "No Kings" werden an diesem Samstag in den USA erneut Millionen Menschen auf die Straßen gehen, um gegen Trumps Politik zu demonstrieren. Vorab habe ich mit Ezra Levin, einem der Hauptorganisatoren hinter den Protesten, gesprochen. Warum er Trump nicht als Feind sieht – und die Demokraten aus seiner Sicht endlich echten Widerstand zeigen, lesen Sie hier (+).
Es war einmal in Amerika

AP
Der eine, Donald Trump, ging vergangene Woche, trotz immensen Werbens für sich selbst, leer aus – der andere, Martin Luther King, bekam ihn 1964: den Friedensnobelpreis. Das Foto hier soll ihn zeigen, wie er im Bett liegend die Nachricht entgegennimmt. Im Jahr zuvor hatte King in seiner berühmten Rede in Washington vor 250.000 Menschen davon gesprochen, dass er einen Traum habe von Gleichheit, Brüderlichkeit unter Schwarzen und Weißen in Amerika. Noch heute, oder gerade heute, lohnt es sich, den einen oder anderen Satz daraus noch mal zu lesen: "I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by content of their character." Vier Jahre später, im April 1968, wird King in Memphis erschossen.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Kein Preis für Trump
Liebe Leserinnen und Leser,
Donald Trump dürfte am Freitagmorgen verärgert auf sein Handy geblickt haben. Kein Anruf aus Oslo, keine Glückwünsche, kein Preis. Der diesjährige Friedensnobelpreis ging an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado – obwohl Trump, wie er selbst sagt, den "größten Deal aller Zeiten" eingefädelt hat: einen Waffenstillstand in Gaza.
Der Jubel war groß, als Trump die frohe Botschaft am Mittwochabend via "Truth Social" verbreitete. Auf dem Geiselplatz in Tel Aviv lagen sich die Menschen in den Armen, sie sangen und tanzten – voller Hoffnung auf die baldige Rückkehr der Geiseln. Und auch in Gaza-Stadt war die Erleichterung riesig.
Die erste Phase von Trumps Abkommen klingt tatsächlich nach Hoffnung: Israel zieht schrittweise seine Truppen aus dem Norden Gazas ab, im Gegenzug sollen alle israelischen Geiseln freikommen – und dringend benötigte Hilfsgüter erstmals wieder ungehindert in das zerstörte Kriegsgebiet gelangen. "Wenn das alles wie geplant geschieht, ist das an und für sich schon eine enorme Errungenschaft und eine, für die Trump große Anerkennung verdient", sagte mir Mona Yacoubian, eine führende Nahost-Expertin in Washington, am Telefon. Und doch warnte sie davor, voreilig das Ende des Krieges auszurufen (+).
Die erste Phase von Trumps Abkommen klingt tatsächlich nach Hoffnung: Israel zieht schrittweise seine Truppen aus dem Norden Gazas ab, im Gegenzug sollen alle israelischen Geiseln freikommen – und dringend benötigte Hilfsgüter erstmals wieder ungehindert in das zerstörte Kriegsgebiet gelangen. "Wenn das alles wie geplant geschieht, ist das an und für sich schon eine enorme Errungenschaft und eine, für die Trump große Anerkennung verdient", sagte mir Mona Yacoubian, eine führende Nahost-Expertin in Washington, am Telefon. Und doch warnte sie davor, voreilig das Ende des Krieges auszurufen (+).

Der Moment, als Trump per Notiz erfährt, dass ein Deal in Gaza kurz bevorsteht. Francis Chung / CNP / Polaris
Denn so sehr Trump sich nun als Friedensstifter inszeniert, so brüchig ist das Fundament seines Deals. Schon Phase zwei – die Entwaffnung der Hamas und der vollständige Rückzug israelischer Truppen – birgt enorme Herausforderungen und erinnert an den Jahresbeginn, als es schon einmal einen Waffenstillstand gab, bis Israel diesen gebrochen hatte.
Yacoubian blickt zudem skeptisch auf den "Tag danach" in Gaza, der eine noch viel größere Herausforderung werden dürfte. Wer soll nach dem Rückzug der Israelis die Kontrolle übernehmen? Welche Sicherheitsgarantien sind geplant? Und woher kommen die Milliarden für den Wiederaufbau? Auf diese Fragen gibt es in Trumps Plan höchstens vage Antworten.
Dennoch zeigt der US-Präsident, dass er mit seiner unkonventionellen Verhandlungsstrategie tatsächlich etwas bewegen kann. Mein Kollege Marc Etzold hat daher gute Nachrichten für Trump: Er kann den Nobelpreis noch immer bekommen. Was er dafür tun muss, lesen Sie hier.
Take care,
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.
Leonie Scheuble
aus Washington, D.C.

Rückblick
Es gab Zeiten, in denen war Marjorie Taylor Greene der größte Fan von Donald Trump. Ihr Motto: je verrückter, je verschwörungstheoretischer, desto besser. Doch jetzt geht sie auf Abstand zu Trump. Sie sei nicht die "blinde Sklavin" des Präsidenten, sagte sie in dieser Woche. Sie kritisiert, dass Millionen Amerikaner ihre Gesundheitsversicherung verlieren könnten. Wie genau es zum Bruch zwischen Taylor Greene und Trump kam, erklärt der "Atlantic".

Einblick
Ein erster Schritt zum Frieden in Gaza ist nun gemacht – doch wo lauern die Fallstricke? Und wie laufen solche Verhandlungen über Krieg und Frieden eigentlich ab? Der ehemalige deutsche Botschafter in Washington und langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, blickt in unserer Rubrik "Ischingers Welt" hinter die Kulissen der Diplomatie.

Ausblick
Während Donald Trump in Chicago die Nationalgarde aufmarschieren lässt, inszeniert sich in Illinois Gouverneur J. B. Pritzker gekonnt als Gegenspieler. Dabei hat der Demokrat mit Trump sogar einiges gemeinsam. Beide Männer stammen aus gutem Haus, beide sind politische Quereinsteiger – und auch Pritzker hat Ambitionen auf das Weiße Haus (+).
Fotofinish

Getty Images
Dieses Mal war es nicht sie, die Anklage erheben ließ – bei der Anhörung vor dem Senats-Justiz-Komitee musste Generalstaatsanwältin Pam Bondi selbst vor den Augen der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen. Demokraten warfen ihr vor, das Justizministerium zu instrumentalisieren, um für Trump politische Gegner zu verfolgen. Ihre Antwort, im Stil der Trump-Regierung: Sie beschimpfte ihre Kritiker als Lügner. Die Anhörung ähnelte manchmal einer verbalen Kampfsportveranstaltung – dem Chef drüben im Weißen Haus dürfte es gefallen haben.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen
Inside America

Das Leben einer "Crunchy Mum"
Liebe Leserinnen und Leser,
ich beschäftige mich häufig mit Gesundheitsthemen, und auf meinen Recherchen hier in den USA habe ich nun einen neuen Begriff kennengelernt: "Crunchy Mums". So nennen sich junge, vor allem weiße Mütter, die der "Make America Healthy Again"–Bewegung (MAHA) von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. angehören. "Crunchy" heißt auf Deutsch knackig oder frisch oder knusprig, der Begriff wird normalerweise im Zusammenhang mit Müslis verwendet. Diana Atieh ist eine solche "Crunchy Mum", ich habe sie in einem Café in dem texanischen Dorf Liberty Hill in der Nähe von Austin getroffen. Dort lebt sie mit ihrem Mann und ihrer vierjährigen Tochter. Sie erklärte mir ihren "Crunchy"-Lifestyle so: „Ich will, dass mein Kind nicht mit so vielen Medikamenten, Impfungen und stark verarbeiteten Lebensmitteln aufwächst“, sagte sie.
Das klingt erst mal ganz vernünftig und harmlos. Aber inzwischen vereint die Bewegung eine Allianz aus rechten und linken Konservativen, die oft ihre Kinder zu Hause unterrichten, tief religiös sind und der modernen Medizin grundsätzlich misstrauen. Sie eint die Ablehnung von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Impfungen aller Art. Atieh lebt, wie so viele MAHA-Fans, in einer Welt, in der, angeführt von Robert F. Kennedy, zahlreiche Verschwörungstheorien propagiert werden.
Die 28-Jährige hatte zum Treffen ihre eigene Wasserflasche mitgebracht. Dem Leitungswasser, das es im Café zum Trinken gibt, traut sie nicht. "Darin sind viele Chemikalien enthalten, und es wird mit Fluorid versetzt, das schädigt das Gehirn", sagte sie. "Ich will mich nicht mehr länger vergiften lassen." In ihrem Haus haben sie deshalb eine Filteranlage eingebaut.

"Crunchy mom" Diana Atieh. Alexandra Kraft
Die Instagram-Influencerin verklärt wie so viele "crunchy mums" die Vergangenheit. "Ich hätte gerne die guten, alten Zeiten zurück, als alles besser war und alle gesünder waren." Ihre Tochter will sie zu Hause unterrichten: "Ich möchte nicht, dass ihr Ideen über Sexualität und Rasse aufgezwungen werden", sagte sie mir.
Woher sie ihre Informationen bekommt? Atieh, die auch als Fotografin arbeitet, antwortete schnell: "Ich habe an der Universität von Berkeley studiert, ich weiß, wie man Studien liest. Ich lasse mich nicht mehr von Ärzten und Wissenschaftlern belügen." Eines ihrer wichtigsten Argumente im Gespräch ist: "Es gibt auch andere Fakten." Bei Widerspruch wechselt sie schnell das Thema, statt darauf einzugehen – eine Strategie, die auch Robert F. Kennedy geschickt einsetzt.
In Liberty Hill lebt Atieh fast nur unter Gleichgesinnten. "Wir sind extra aus Kalifornien hierhergezogen, dort fühlte ich mich unter Druck gesetzt, wir hätten unsere Tochter dort auch impfen lassen müssen gegen mehrere Krankheiten, das wollten wir nicht." Auf die Frage, ob sie nun ganz auf Impfungen verzichtet habe, lächelte sie, dann überlegte sie kurz: "Darüber möchte ich nicht reden, es gibt so viele verrückte Menschen in der Welt." Selbst geht sie kaum mehr zum Arzt. "Ich kann mich ohne Hilfe heilen", sagte sie. Und schob noch hinterher: "Ich hoffe, dass RFK endlich mit der Pharma- und Lebensmittelindustrie abrechnet."
Take care
Alexandra Kraft
aus Liberty Hill, Texas
aus Liberty Hill, Texas

Rückblick
Wie mag sich wohl dieser Pete Hegseth, siehe oben, seinen perfekten "Krieger" vorstellen? Und was macht so ein Soldat idealerweise den ganzen Tag lang, um dem Ideal gerecht zu werden? Das fragte sich auch Kollege Yannik Schüller – und liefert die Antwort (+). Nicht ganz ernst gemeint. Oder ein wenig vielleicht doch?

Einblick
Er ist der dunkle Einflüsterer des Präsidenten. Wenn Trump der Bauch-Mensch ist, dann ist Stephen Miller der kühl kalkulierende Kopf. Offiziell ist Miller nur Vize-Stabschef im Weißen Haus, tatsächlich aber reicht sein Einfluss viel weiter. Die Massenabschiebungen, der Beschuss von Drogenboten, Militäreinsatz im Innern – all das sind Millers Ideen. Mit seiner radikalen Politik, schreibt Marc Etzold (+), bringt Miller übrigens sogar die eigene Familie gegen sich auf.

Ausblick
Während sich hier in den USA der mühsame Shutdown, also der Regierungsstillstand, weiter hinzieht, wird am Freitag kommender Woche in Oslo etwas verkündet, das viel mehr im Kopf von Donald Trump herumspukt – wer 2025 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Trump erwartet, klar, dass er den Preis erhält. Alles andere wäre "eine Beleidigung für die Vereinigten Staaten", tönte er gerade wieder. Die Mehrheit der Amerikaner sieht es allerdings anders. In einer "Washington Post"-Umfrage sagten 76 Prozent, Trump habe die Auszeichnung nicht verdient.
Es war einmal in Amerika

Imago
Die Stimmung ist gut auf den Sofas im Oval Office. Kein Wunder – schreiben diese beiden Männer doch Geschichte. Es ist 1967, in den Jahren zuvor hat der Mann rechts im Bild, US-Präsident Lyndon B. Johnson, die Bürgerrechtsgesetze unterzeichnet, die die Rassentrennung und die Diskriminierung schwarzer Bürger in den USA offiziell beenden. Nun der nächste Schritt, und dabei spielt der Mann links die Hauptrolle. Sein Name ist Thurgood Marshall – und Johnson setzt ihn als ersten schwarzen Richter am Supreme Court durch. 24 Jahre lang wird er dort Recht sprechen.
See you next time!
Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns an insideamerica@stern.de.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Gefällt Ihnen der Newsletter oder hat ihn Ihnen jemand weitergeleitet? Unter diesem Link können Sie "Inside America" weiterempfehlen oder abonnieren.
Link kopieren
Auf Facebook teilen
Auf X teilen
Per E-Mail teilen