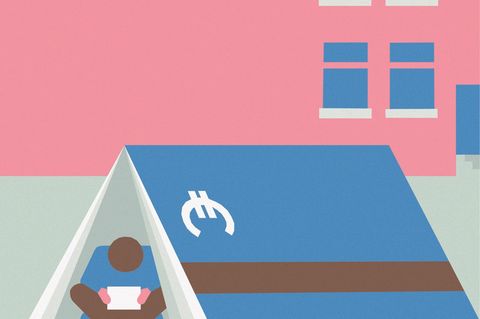Manche Kreditinstitute verweisen bei Sparbüchern, in denen seit Jahrzehnten keine Bewegung mehr verzeichnet wurde, darauf, dass das Konto aufgelöst und das Guthaben ausbezahlt sei. Auch die Verjährung der Forderung werde oft ins Feld geführt, sagt Petra von Rhein, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern in München. Von solchen Argumenten sollte sich der Kunde aber nicht entmutigen lassen.
»Wer ein noch gültiges altes Sparbuch vorlegen und sich als Erbe oder Verfügungsberechtigter ausweisen kann, darf auch über das Geld verfügen«, sagt nämlich Thomas Schlüter, Pressesprecher des Bundesverbandes deutscher Banken in Berlin. Aus steuerrechtlicher Sicht bestehe für die Banken zwar die Möglichkeit, nach 30 Jahren solche Altguthaben zu vereinnahmen. Es werde jedoch in aller Regel versucht, noch über diesen Zeitraum hinausgehende Vorgänge zu rekonstruieren - und dann auch das Geld auszuzahlen. Ein Problem sei für viele Banken jedoch in der Tat, dass früher zuweilen auch ohne Vorlage des Sparbuches das darauf befindliche Geld abgehoben wurde.
Beweislast ist manchmal strittig
Besonders bei größeren Beträgen sollten Sparbuchinhaber trotzdem versuchen, ihre Ansprüche durchzusetzen, rät Verbraucherschützerin von Rhein. Verweigere das Kreditinstitut die Auszahlung, sei ein Erfolg vor Gericht zwar nicht garantiert, aber auch nicht ohne Chancen.
Denn grundsätzlich genügt der Kunde schon seiner Beweispflicht, wenn er ein nicht entwertetes Sparbuch präsentieren kann. Behauptet die Bank, sie habe bereits ohne Vorlage alles ausgezahlt, so muss sie dies auch beweisen können. Nach einem Urteil des Amtsgerichts Bielefeld reicht hierfür ein Vermerk in der internen Inventurliste der Bank (Az: 15 C 352/95): Ist dieser Eintrag vorhanden, liege die Beweislast beim Kunden.
Genau umgekehrt entschieden das Landgericht Wuppertal (Az: 9 S 314/97), das Oberlandesgericht Frankfurt/Main (Az: 23 U 166/96) sowie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (veröffentlicht in NJW 1989, 1518). Sie sprachen Sparbucheigentümern einen Anspruch auf Auszahlung des Guthabens zuzüglich Zinsen zu. Verfüge eine Bank nicht mehr über ausreichende Unterlagen, mit denen sie die Auszahlung beweisen könne, dürfe dies nicht zu Lasten des Kunden gehen.
Achtung vor der Verjährung
Auch die Hamburger Sparkasse zum Beispiel recherchiere in jedem Fall noch weit über die Verjährungsgrenze von 30 Jahren hinaus, sagt deren Pressesprecher Ulrich Sommerfeld. Angenommen, ein Enkel finde nach dem Tod der Oma ein nicht entwertetes Sparbuch der Hamburger Sparkasse von 1948, dem Jahr der Währungsreform, könne er »über die Spareinlage plus Zinsen verfügen, wenn er erbberechtigt ist«.
Auch wenn vor langer Zeit nur ein kleiner Betrag eingezahlt wurde, kann sich auf manchem alten Sparbuch im Lauf der Zeit durch die Zinsen ein kleines Vermögen angesammelt haben. Wurden beispielsweise vor 52 Jahren 1.000 Mark eingezahlt, dann sind daraus im Jahr 2000 bei einem durchschnittlichen Zinssatz von fünf Prozent 12.600 Mark geworden.
Für Sparguthaben aus der so genannten Reichsmarkzeit gebe es allerdings kein Geld mehr, sagt Petra von Rhein. Der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland habe 1975 entschieden, dass mit Ablauf des 30. Juni 1976 angesichts der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren Beträge aus Konton, die seit Kriegsende 1945 nicht mehr bewegt worden sind, nicht mehr erlöst werden dürfen.
Enteigenungsregelungen sind für Ost und West unterschiedlich
Nach dem Krieg sind nach Angaben der Verbraucherzentrale Bayern für diejenigen Personen, die auf Grund der Schließung und Enteignung von Banken und Sparkassen ihre Vermögenswerte verloren hatten, in beiden deutschen Staaten unterschiedliche rechtliche Regelungen getroffen worden. Die ehemalige DDR hat aus einer so genannten Altguthaben-Ablösungs-Anleihe Entschädigungen geleistet. Dies hat sie jedoch nur für ihre Bürger getan, und nur dann, wenn das Kreditinstitut seinen früheren Sitz auf dem Gebiet der DDR hatte.
In der Bundesrepublik wurden Entschädigung an Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Lastenausgleichs gezahlt. Dabei wurden auch die Verluste berücksichtigt, die ihnen durch Schließung und Enteignung von Banken entstanden waren. Neben dem Lastenausgleich wurde eine so genannte Westvermögen-Abwicklung durchgeführt: Wurde eine Bank von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet, wurden die Vermögenswerte des Kreditinstitutes in den westlichen Bundesländern in einem konkursähnlichen Verfahren an die ehemaligen Kunden ausgezahlt.