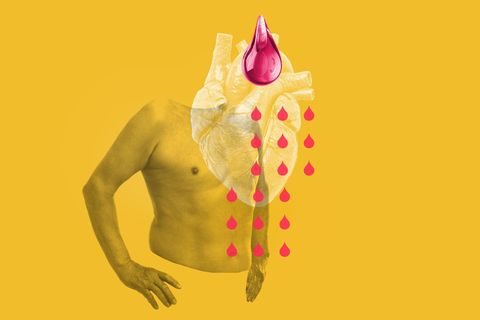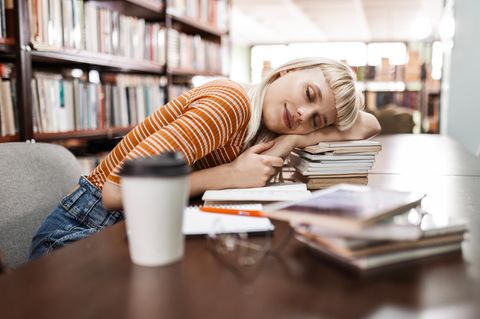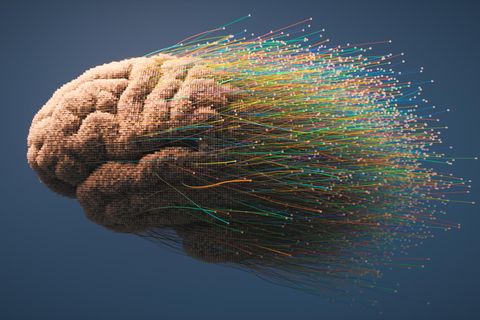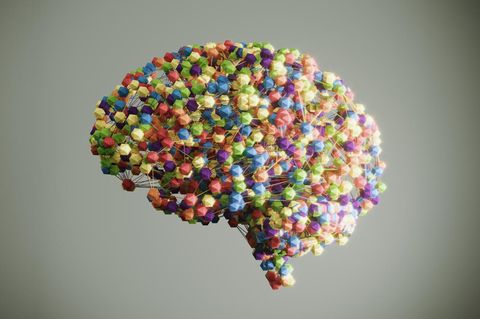Herr Peters, vor Kurzem wurde in den USA eine Studie mit mehr als 10 000 Diabetikern vom Typ 2 vorzeitig abgebrochen. Unter Patienten mit einem besonders niedrig eingestellten Blutzucker waren mehr Todesfälle aufgetreten als bei einer Vergleichsgruppe, deren Werte nicht so stark gesenkt worden waren. Hat Sie das bestürzt?
Ich arbeite seit 24 Jahren in der Forschung, aber so etwas habe ich noch nie erlebt! Diese Studie ist eine der größten überhaupt, die je zur Therapie von Diabetes durchgeführt worden ist. Sie sollte eigentlich über zehn Jahre oder noch länger laufen und wurde nun bereits nach vier Jahren gestoppt. Bislang waren sich Diabetologen einig, dass es gut ist, den Blutzucker auf ein niedriges Niveau zu drücken. Diese Empfehlung ist zu überdenken.
Was ist das Problem dabei?
Das Ziel der strengen Therapie ist, den hohen Blutzucker der Patienten besonders effizient zu senken. Nicht bedacht wird, dass mithilfe des Insulins der überschüssige Blutzucker vor allem ins Fettgewebe und in die Muskeln geschoben wird. Der Transport des Zuckers zum Gehirn wird dagegen gebremst. Das somit unterversorgte Hirn beginnt Nachschub anzufordern.
Was bedeutet das?
Es wird unter anderem das Stresssystem aktiviert: Das Herz der Patienten schlägt schneller, um möglichst rasch möglichst viel Blutzucker in Richtung Gehirn zu pumpen. Bei einem gesunden 25-Jährigen wäre das kein Problem. Wenn der Patient aber 62 Jahre alt ist und seine Blutgefäße verkalkt und brüchig sind, dann macht sein Herz das nicht mehr mit. Zumal die Diabetespatienten in dieser Studiengruppe ohnehin schon ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hatten. Ich vermute, dass viele von ihnen an Herzversagen starben.
Ist die strenge Blutzucker-Einstellung also der falsche Weg?
Das Ziel der rigorosen Senkung des Blutzuckers in etwa auf das Niveau eines gesunden Menschen finde ich an sich erstrebenswert. Das entspräche einem sogenannten HbA1c-Wert von sechs. Das war allerdings genau der Blutzuckerspiegel, bei dem in der Studie die meisten Todesfälle aufgetreten sind. Daher müssen wir die Methode überdenken, mit der wir dieses Ziel erreichen wollen. Schließlich soll die strenge Therapie Gefäßschäden langfristig verhindern. Wir müssen das Gehirn in die Therapie mit einbeziehen und sicherstellen, dass es gut versorgt ist. Nur so können wir die Behandlung weiter optimieren.
Ihr Forschungsprojekt des "Selfish Brain", des selbstsüchtigen Gehirns, beschäftigt sich mit ebendiesem Aspekt. Was steckt dahinter?
Wir haben Belege dafür, dass in unserem Körper alles darauf ausgerichtet ist, das Gehirn mit ausreichend Energie zu versorgen. Dorthin gelangt beim gesunden Menschen in Ruhe die Hälfte des Zuckers, der mit der Nahrung aufgenommen wird. Bei Übergewichtigen – und Typ-2-Diabetiker sind fast immer übergewichtig – kann das Hirn kaum Energie aus dem Körper anfordern. Also gibt es den Befehl, mehr zu essen, um einen Energiemangel zu verhindern. Der Patient nimmt an Gewicht zu, und sein Diabetes verschlimmert sich.
Was sind die Ursachen für die Störung?
Im Gehirn fallen verschiedene Kontrollzentren aus. Das kann neben bekannten Ursachen wie genetischen Defekten auch durch Kopfverletzungen, Medikamente, traumatische Erfahrungen oder Schadstoffe aus der Umwelt geschehen. Womöglich spielen dabei sogar Viren eine Rolle. Das selbstsüchtige Gehirn sendet nun ständig Befehle zur Nahrungsaufnahme aus. In der Folge kann sich Essen bei den Patienten zur alleinigen Reaktionsweise bei Stress oder Konflikten entwickeln. Tröstet sich der Mensch lieber mit Süßigkeiten, als die Konfrontation mit seinem Chef zu suchen? Dann hat er sich das Essen als Strategie gesucht, um Stress zu mindern.
Wie kann man den Patienten helfen?
Wir entwickeln derzeit das Therapiekonzept "Train the Brain", um bestimmte Verhaltensweisen zu verändern. Dazu gehören nicht nur schlechte Essgewohnheiten. Emotionen spielen dabei eine große Rolle – Ärger etwa, Trauer, Einsamkeit. Die Gefühle sagen eigentlich genau, welche Bedürfnisse ein Mensch in dem Moment hat. Fühlt er sich allein, sollte er zum Beispiel einen Freund anrufen. Doch manche Patienten können ihren Emotionen nicht mehr auf den Grund gehen. Sie fühlen sich nur ganz diffus schlecht und gestresst – und beginnen zu essen, um sich besser zu fühlen. Ihnen diese Gewohnheiten abzutrainieren, die Wahrnehmung ihrer eigenen Bedürfnisse zu schärfen, sollte neben dem Einsatz neuer, zielgerichteter Medikamente ein wichtiger Bestandteil der Diabetestherapie sein.
Interview: Astrid Viciano