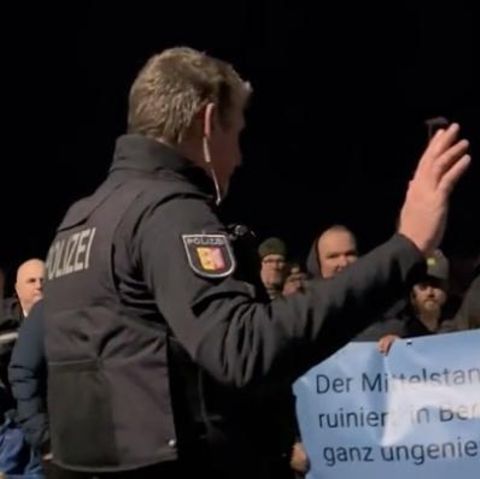"Wir machen das alles nicht nur für uns, sondern auch für die Verbraucher", sagt Marie Hoffmann. Alle sollen sich alles leisten können: die Bauern die Produktion, die Kunden regionale Lebensmittel. Deshalb hat sich Hoffmann mit Dackeldame Asta in die Fahrerkabine ihres Treckers gesetzt. Schon am ersten Tag der bundesweiten Bauernproteste war die 26-jährige Landwirtin und Agrarinfluencerin mit dabei. Gemeinsam mit Kollegen rollte sie über die B 1 zwischen Soest und Werl in Nordrhein-Westfalen.
Angetrieben wurden Hoffmann und die anderen Landwirte von ihrer Wut über die Sparpläne der Bundesregierung. Vordergründig geht es um den Agrardiesel-Preis, der nicht mehr subventioniert werden soll. Verärgert sind die Bauern aber schon sehr viel länger – weil die Regierungen in Berlin und Brüssel ihnen einiges abverlangen. Mehr Tierwohl in der Haltung zum Beispiel oder mehr Artenschutz auf Feld und Acker.
Beides ist grundsätzlich richtig, finden auch die Bauern. Schließlich sind Umwelt- und Klimaschutz auch in ihrem Interesse. Man wolle nicht länger der Buhmann sein, der für Insektensterben und Nitrat im Grundwasser verantwortlich sei, sagt Marie Hoffmann.
Deutschlands Agrarpolitik schlingert
Allerdings ist die Ökobilanz der Landwirte alles andere als unproblematisch. Bauernpräsident Joachim Ruckwied weist zwar darauf hin, dass die Landwirtschaft mit Tierhaltung und Düngung sieben Prozent der deutschen Emissionen verursachen. Das stimmt auch, allerdings nur solange man die Landnutzung außer Acht lässt. Werden die Herstellung von Mineraldünger, Pestiziden und Importfuttermittel einberechnet oder auch Stallheizungen, Spritpreise und die Umwandlung von Landflächen in Äcker, kommt man auf 14 Prozent. Für das Jahr 2022 dokumentierte das Umweltbundesamt einen CO2-Ausstoß von über 60 Millionen Tonnen – weniger als im Jahr zuvor. Der Bundesregierung reicht das jedoch nicht. Sie will, dass die Landwirte ihre Emissionen bis 2030 auf 56 Millionen Tonnen senken. Fünfzehn Jahre später soll der Sektor – wie der Rest der Bundesrepublik – klimaneutral sein.
Bei der Halbzeitbilanz der Ampel-Regierung Anfang Dezember wähnte Grünen-Politikerin Renate Künast die Landwirtschaft auf einem guten Weg und bezog sich auf die Kennzeichnung bei der Tierhaltung und die Bio-Strategie 2030. Fragt man die Landwirte selbst, kommt man zu einem anderen Ergebnis. 95 Prozent bezeichneten die Agrarpolitik der Bundesregierung in einer Umfrage des Online-Portals "Agrar Heute" als nicht oder gar nicht erfolgreich. Nur zwei Prozent der 2000 Befragten teilten Künasts Einschätzung.
Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen: Zu Beginn ihrer Amtszeit schrieb die Ampelkoalition in Berlin zehn verbindliche Klima-Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft vor. Die Bauern waren zufrieden. Emissionen sollten reduziert werden, die Landwirte ressourcenschonender arbeiten und nachhaltiger produzieren. Heute können viele Landwirte über die in ihren Augen "planlose" Agrarpolitik nur den Kopf schütteln. Cem Özdemir und sein Ministerium rechnen damit, dass die Emissionen im Agrarsektor bis 2025 um ein bis knapp drei Millionen Tonnen sinken können. Nur, fragen sich viele, wie soll das gehen ohne konkretere Fahrpläne und Ziele?
Landwirte wollen weg vom Diesel
Möglichkeiten gäbe es einige. Zum Beispiel könnten Landwirte Kohlenstoff im Boden speichern, sagt Marie Hoffmann, die junge Landwirtin. "Dadurch können wir nicht nur klimaschonend wirtschaften, sondern auch aktiv zum Klimaschutz beitragen, weil wir das CO2 aus der Atmosphäre binden." Regenerative Landwirtschaft nennt sich das. Dabei wird der Boden so bearbeitet, dass sich auch Pflanzen und Tiere darin wieder wohler fühlen. Und nebenbei wird der Boden so besser auf Extremwetterereignisse vorbereitet, was wiederum die Ernte schützt. Noch ziehe nicht jeder mit, sagt Hoffmann – aber der Trend sei da.
Schwieriger gestaltet sich derweil die Suche nach Alternativen für den Diesel, auf den die Mehrheit der deutschen Traktoren nach wie vor angewiesen ist. Das Kraftfahrtbundesamt zählt fast 300.000 Schlepper in ganz Deutschland, allein im vergangenen Jahr wurden über 30.000 neue zugelassen. Landmaschinen verbrennen jährlich rund zwei Milliarden Liter Diesel. Fünf Millionen Tonnen CO2 werden so freigesetzt, das sind etwa sieben Prozent der gesamten Agraremissionen.
"Wir wollen nicht ewig auf unserem Diesel herumreiten", sagt Landwirtin Hoffmann. Über Alternativen verliert die Bundesregierung allerdings kaum ein Wort – obwohl die Feldarbeit neben Transport und Tierhaltung der größte Energiefresser im Agrarsektor ist und Branchenexperten zum Umdenken mahnen. "Neben der Umstellung auf erneuerbare Antriebsenergien ist auch die Reduktion des Kraftstoffbedarfs ein wesentlicher Hebel zum Klimaschutz in der Landwirtschaft", heißt es in einem Bericht des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (Ktbl).
Bisher keine Alternativen für die Landwirtschaft
Pioniere auf dem Gebiet gibt es kaum. 2019 wurde der erste kabelgebundene Prototyp auf den Acker geschickt. Vor 2040 wird die Maschine nach Einschätzung von Branchenexperten aber kaum praxisreif sein. Im bayerischen Landkreis Traunstein tüfteln Landwirte an einem E-Traktor, der 2025 in einer Miniserie auf den Markt kommen soll. Der Hersteller Fendt bietet mit Wasserstoff betriebene Kleintraktoren an. Und mit Methan betankte Trecker gibt es beim Hersteller New Holland.
Auch Hoffmann plädiert dafür, Abfälle, Mist und Gülle in Biogas umzuwandeln. LNG (Flüssiggas) oder CNG (Erdgas) könnten den Diesel ablösen und auch für die Verbraucher ins Gasnetz eingespeist werden. Nur werden die dafür nötigen Anlagen aus Sicherheitsgründen noch zu selten genehmigt. Aber es ist auch eine Frage des Geldes: "Biogasanlagen umzurüsten würde mehrere zehn-, wahrscheinlich sogar 100.000 Euro kosten", erklärt sie.
Strittig bleibt auch, ob die alternativen Antriebsaggregate genauso leistungsfähig wären wie aktuelle Diesel-Traktoren. Für die Ernte sind die Maschinen laut Ktbl teilweise zwölf Stunden im Einsatz. So weit sind Trecker mit Elektroantrieb und Co. bisher aber noch nicht.
Und da sind auch noch die Kosten: Ein Investitionsprogramm der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung rechnet vor, dass Maschinen mit elektrischem Antrieb ungefähr 30 bis 40 Prozent teurer sind. Bei CNG-Maschinen müssten Landwirte 25 Prozent mehr bezahlen. Das können sich nicht alle leisten – auch wenn sie es gerne würden.
Der Lobbyverein Foodwatch sieht das ein wenig anders: "Die Probleme im Agrarsektor lassen sich nicht mit vergünstigtem Diesel lösen", sagt Geschäftsführer Chris Methmann. Nachhaltig könne die Landwirtschaft nur werden, wenn die Billig-Exporte für den Weltmarkt beendet würden. Das System solle zudem Höfe belohnen, "die umweltverträglich wirtschaften und Arbeitsplätze im ländlichen Raum schaffen".
Fest steht: Ein Systemwechsel ist nötig. Aber den können die Landwirte nicht alleine stemmen. "Besonders meine jungen Kollegen sind sich des Klimawandels bewusst und wollen, dass auch die nächsten Generationen auf dieser Erde leben und mit der Natur arbeiten können", sagt Landwirtin Hoffmann. Nur wie sie das schaffen sollen ohne politische Unterstützung, ohne klare Zielvorgaben und Alternativen kann derzeit niemand beantworten.