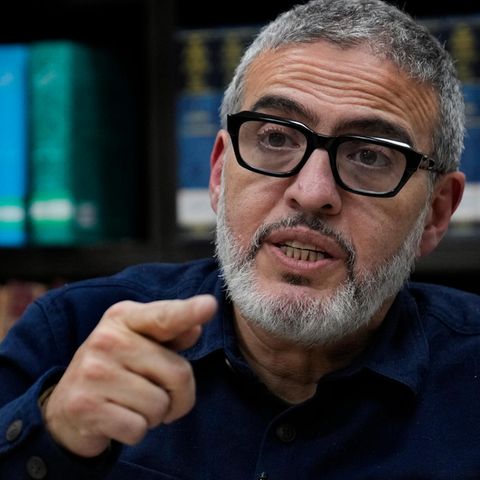Am Dienstag veröffentlichte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" eine Auswertung zu Angriffen auf Journalisten, laut der sich die Zahl der gewaltsamen Übergriffe gegen Medienschaffende im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat. Die meisten Vorfälle ereigneten sich demnach auf Kundgebungen, vorwiegend zum Nahostkonflikt. Aus diesem Grund publizieren wir nachfolgendes Interview mit der Szene-Expertin Pia Lamberty erneut.
Frau Dr. Lamberty, in der linken Berliner Szene soll laut dem Journalisten Nicholas Potter "eine Art Feindesliste" mit Namen und Adressen von unliebsamen Journalisten kursieren, Potter selbst sieht sich durch einen Sticker auf Straßenlaternen und Litfasssäulen angeprangert. Ist das eine neue Dimension von Pressefeindlichkeit?
Seit Jahren beobachten wir in verschiedenen Milieus eine zunehmende Pressefeindlichkeit, Hetze im Netz und auch körperliche Gewalt gegen Journalisten, vor allem unter Querdenkern und Rechtsextremisten. Doch seit den Massakern der Hamas in Israel im Oktober 2023 und dem Krieg in Gaza hat sich ein weiteres pressefeindliches Milieu gebildet. Nicholas Potter ist einer der Journalisten, die stark in dessen Fokus stehen, weil er zum linken Antisemitismus recherchiert hat.
Potter warnt vor einer "Intifada gegen die Presse", als Urheber nennt er eine "sich propalästinensisch gerierende Linke". Ein Problem speziell in Berlin?
Nein, das gibt es auch anderswo. In Mainz beispielsweise beschimpfte ein Redner einer linken Palästina-Initiative im Mai 2024 Journalisten als "rechten Abschaum".

Zur Person
Pia Lamberty, 41, ist deutsche Sozialpsychologin. Sie ist Mitgründerin des Berliner Centers für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CeMAS. Die gemeinnützige Organisation entstand im Jahr 2021. Die Experten beobachten dort aktuelle Entwicklungen zu den Themen Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Lamberty erhielt aufgrund ihrer Arbeit selbst Drohungen
Woher rührt die pressefeindliche Stimmung von Israel-Kritikern?
Man muss differenzieren zwischen Menschen, die sich für die Menschen in Gaza einsetzen, und einer radikalisierten Gruppe, die ein antisemitisches Weltbild hat und Pressefeindlichkeit als Teil der eigenen Ideologie sieht. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass bei Besetzungen oder Protesten der klassischen Presse wiederholt der Zugang verwehrt wurde. Propagandistische Medien bekommen dagegen Zugang, wie beispielsweise das englischsprachige digitale Portal "Red", das Bezüge zu Russland hat. Auf "Red" wird das Thema Israel und Gaza massiv bespielt.
Potter hatte über das Portal "Red" im Oktober berichtet, es sei "mutmaßlich aus Russland finanziert" und biete "islamistischen Terrororganisationen eine Plattform". Die Instagram-Accounts wurden voriges Jahr gesperrt. Welche Rolle spielt es heute?
Seit die Instagram-Accounts gesperrt wurden, hat "Red" zwar dort weniger Reichweite, ist aber auf Telegram weiter aktiv, dort hat es 21.000 Follower, außerdem 120.000 Follower bei X. Auf Telegram erschien am 17. Dezember Potters Bild mit Schmähungen und als angeblich von Israel angeheuerter Propagandajournalist. Die Sticker auf den Litfasssäulen beziehen sich direkt auf dieses Posting.
Wurde der Protest gegen die israelische Kriegsführung gekapert, beispielsweise von Plattformen wie Red?
Der Nahostkonflikt war schon immer auch eine Projektionsfläche für Instrumentalisierung. Auch der Kreml nutzt Antisemitismus seit Ewigkeiten als Vehikel für Propaganda und Desinformation. Viele Länder nutzen den Konflikt zwischen Israel und Palästina auch, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Seit der Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse wird der Konflikt durch verschiedene Akteure wie Russland oder Iran verstärkt genutzt, um antisemitische Ressentiments zu befeuern. Die Einteilung in Gut und Böse eignet sich leider sehr dafür. Dabei geht es oft weniger um die reale Lage der Menschen vor Ort oder wie der Konflikt beendet werden kann, sondern ganz viel um Projektion.
Sie beobachten systematisch den in Russland entwickelten Messenger Telegram. Wo sehen Sie ansonsten Feindseligkeiten gegen Journalisten?
Die Proteste von Verschwörungsideologen sind aktuell massiv zurückgegangen, damit auch Gewalt und Gewaltandrohungen aus diesem Milieu gegen Pressevertreter. Das kann sich allerdings jederzeit ändern. Das sah man beispielsweise vergangenes Jahr bei den Bauernprotesten, auch dort wurden Medien schnell zum Feindbild. Aktuell finden verstärkt wieder Demonstrationen durch Neonazis statt, auch hier gehört Pressefeindlichkeit dazu.
Im November wurde der Internetauftritt des Recherche-Netzwerks Correctiv tagelang von Hackern lahmgelegt. Correctiv schrieb damals: "Die Spuren führen nach Russland." Welche Strategie erkennen Sie dahinter?
Faktenchecker wie Correctiv mit Falschbehauptungen zu überschwemmen, um deren Arbeit zu behindern, ist auch eine russische Strategie. In vielen Fällen kann man allerdings nicht eindeutig sagen, dass die russische Regierung dahintersteckt. Es gibt auch viele Kampagnen, die nicht direkt vom Kreml gesteuert sind, aber im Sinne der Regierung agieren.
Der Einfluss der etablierten Medien schrumpft – warum wird die Presse überhaupt zur Zielscheibe?
Journalisten sind für demokratiefeindliche Bewegungen immer ein Feindbild. Eben weil sie genau für das stehen, was den Feinden der Demokratie zuwider ist. Menschen, die Fakten recherchieren, die aufklären, passen nicht ins Bild. Darum werden Feindbilder geschürt. Über die Abgrenzung "wir gegen die" schafft man es nicht nur, die anderen zu diskreditieren, sondern zugleich die eigene Gruppe zu stärken. Deshalb sind aus psychologischer Sicht Feindbilder so relevant für die Bildung extremer Gruppierungen.
Warum attackieren sie einzelne Journalisten und nicht das Medium?
Es ist einfacher, sich eine Person herauszupicken, in der Hoffnung, dass sie irgendwann bricht und nicht mehr berichtet. Es gibt aber auch Angriffe aus diesem Milieu heraus beispielsweise auf die "Taz", "Jungle World" und den "Tagesspiegel" als "zionistische Lügenpresse". Potter berichtet, dass sich viele Journalisten zurückziehen und nicht mehr von solchen Protesten berichten, weil es für sie gefährlich wird. Diese Dynamik kennen wir aus der Zeit der Querdenker-Demo. Damals erklärten Journalisten, sie getrauten sich nicht mehr, offen und ehrlich zu berichten, weil die Gefahr so groß sei.
Die Frage sei erlaubt: Was bringt es denn überhaupt, von einer Kundgebung zu berichten, auf der man mit keinem sprechen kann?
Es ist wichtig, dass Journalisten vor Ort sind und recherchieren, was passiert, welche Rolle verschiedene Akteure spielen. Das war schon während der Corona-Demos wichtig und ist es jetzt immer noch. Aber das Risiko für Berichterstatter ist einfach da. Es liegt an den Medienhäusern, aber auch am Gesetzgeber, Regelungen zu schaffen, die Journalisten vor Angriffen schützen. Meine Erfahrung ist, dass Journalisten, die diesem Risiko ausgesetzt sind, oft alleine gelassen werden – das gilt insbesondere für Freiberufler. Es fällt ihnen schwer, über Angriffe gegen sich selbst zu berichten oder über Angriffe auf die eigene Zunft. Aber es ist ein Phänomen, das uns nun seit Jahren begleitet und sich auf die Berichterstattung negativ auswirken kann.
Wie wichtig ist der Rückhalt der Verlage?
Verlage haben eine große Verantwortung. Die Zahlen von Reporter ohne Grenzen zeigen, die meisten Übergriffe finden auf Versammlungen statt. Oft sind es Fotojournalisten, Freiberufler, die noch weniger Schutz haben. Medienhäuser brauchen gute Schutzkonzepte. Dem sogenannten Schutzkodex haben sich einige Medienhäuser angeschlossen, er gibt den Journalisten praktische Hinweise, an wen man sich im Fall der Fälle wenden kann, wo es psychologische und juristische Unterstützung gibt. Das sind sinnvolle Ansätze, um Journalisten nicht alleine zu lassen. Diese Probleme sollte nicht jeder Journalist individuell bearbeiten müssen.
Müssen Reporterinnen und Reporter künftig mit Personenschutz zur Demo?
Bei rechtsextremen Demos gibt es das teilweise schon, dass beispielsweise Fotojournalisten von Sicherheitsleuten begleitet werden, weil die Bedrohungslage sonst so groß ist.
Wie ernst sind anonyme Drohungen gegen Journalisten zu nehmen?
Es gibt zwei Komponenten. Das sind zum einen die physischen Übergriffe seit dem 7. Oktober 2023 bis hin zur gefährlichen Körperverletzung, die wir auch in diesem Milieu sehen. Es wurde auf Objektive und Mobiltelefone geschlagen, einem Journalisten zwischen die Beine getreten, mit Sand und Steinen auf Medienvertreter geworfen. Hinzu kommt die psychologische Seite: Es macht etwas mit Menschen, wenn sie bedroht und beleidigt werden, wenn sie ihren Namen auf Listen wiederfinden. Das erhöht den Stress auch auf die Familien von Journalisten, auf ihre Kinder.
Wie sinnvoll ist es, Strafanzeige zu erstatten?
Es wird nach solchen Übergriffen schon ermittelt, aber oft geschieht das zu langsam. Doch gerade wenn es um digitale Bedrohung geht, um orchestrierte Kampagnen, ist die Frage leider auch: Lohnt es sich? Wer hunderte Hasskommentare bekommt, braucht viel Zeit, um die alle anzuzeigen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es müsste schneller und einfacher gehen. Wenn es in einem Medienhaus keine Struktur gibt, wie man sich gegen Hass und Hetze wehren kann, ist es eine zusätzliche Belastung für den Journalisten.
Wie sind Sie selbst mit Hasskommentaren fertiggeworden?
Mir hat geholfen, dass ich die öffentliche und private Person strikt trenne, also auch keine privaten Informationen poste. Soziale Unterstützung fand ich enorm hilfreich. In Zeiten, als ich über Twitter so viel Hass bekam, dass ich mit dem Blocken nicht mehr durchgekommen wäre, halfen mir andere. Ich lese diese Kommentare nicht durch, sondern habe sie an andere weitergeleitet. Wenn es zu überwältigend wird, hilft es auch, mal eine Pause von der Öffentlichkeit zu nehmen.
Haben damit die Hater gewonnen?
Kurzfristig ja, aber langfristig halte ich es für die eigene Person für sinnvoller, als die Zähne zusammenzubeißen und irgendwann für lange Zeit auszufallen.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen schrieb jüngst, es habe sich in Deutschland "in den letzten Jahren eine immer pressefeindlichere Stimmung ausgebreitet". Fehlt der gesellschaftliche Rückhalt für professionelle Reporter, die noch rausgehen, um Bericht zu erstatten?
Laut einer Medienstudie der Uni Mainz ist das Vertrauen in die Medien momentan wieder so wie vor der Pandemie. Generell genießen die klassischen Medien immer noch großes Vertrauen, aber es gibt Milieus, in denen es anders aussieht, und diese Gruppen sind größer geworden. Wir haben eine große demokratische Mehrheit, die oft sehr still ist und sich mit Bewertung zurückhält, obwohl sie solche Angriffe vielleicht stören. Diese demokratische Mehrheit muss lauter werden.
Steckt ein Körnchen Wahrheit in der Kritik, dass deutsche Medien zu unkritisch über die israelische Kriegsführung berichten?
Das kann ich fachlich nicht einschätzen. Ich kenne für die Zeit nach dem 7. Oktober 2023 keine soliden wissenschaftlichen Studien, die sich das genau angeschaut haben.
Pro-Palästina-Proteste breiten sich an europäischen Unis aus – Bilder zwischen Zorn und Zeltlager
Wie frei ist die Presse in Deutschland heute?
Während der Pandemie wurde die Pressefreiheit heruntergestuft, beispielsweise durch Angriffe von Querdenkern. Es ist ein Unterschied, ob autoritäre Staaten in die Pressefreiheit eingreifen oder solche Gruppierungen. Aber es hat in beiden Fällen Auswirkungen auf die Pressefreiheit, wenn Journalisten sich überlegen, ob sie noch über Themen wie Rechtsextremismus, Nahost oder die Klimakrise schreiben wollen.
Reagieren Medienhäuser bisher zu defensiv auf Angriffe?
Sie sind oftmals noch überfordert. Das Problem begann schon während Pegida mit Lügenpresse-Vorwürfen und Angriffen auf Journalisten, auch bei der AfD passiert das. Dagegen braucht es eine gute Strategie, beispielsweise die Moderation von Social-Media-Beiträgen. Medien brauchen Standards und Leitlinien, damit sie nicht, sobald es einen Shitstorm gibt, einknicken in der Hoffnung, dass man damit den Wind aus den Segeln nimmt. Genau das passiert noch immer viel zu häufig. Daraus lernen Angreifer: Wir müssen nur aggressiv genug sein, dann kriegen wir, was wir wollen.
"Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden", sagte Rosa Luxemburg im Jahr 1918. Hat der Gedanke heute noch eine Chance?
Wenn wir uns öffentliche Debatten anschauen, wirkt es oft so, als würde nur noch die eigene Meinung zählen. Ich glaube aber nicht, dass dies die Realität ist. Geht man raus aus dem Netz, halten Menschen sehr unterschiedliche Realitäten aus, auch unterschiedliche Meinungen und Gewichtungen. Allerdings braucht es auch klare Grenzen der Toleranz. Der Philosoph Karl Popper sagte, wenn man zu viel Toleranz hat für die Intoleranz, dann führt dies "zum Verschwinden der Toleranz." Wenn eine Stadt vollgeklebt wird mit beleidigenden Stickern und dem Bild eines Journalisten, dann ist genau diese Grenze überschritten.