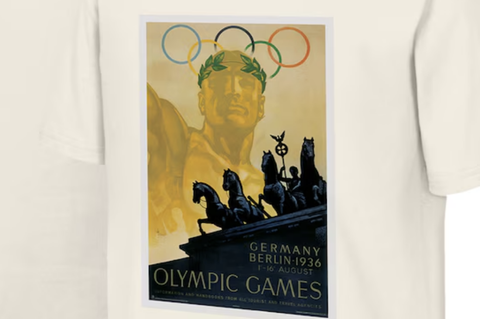Die deutsche Alltagssprache verkommt nach Ansicht der meisten Bundesbürger zunehmend. Einer in Berlin präsentierten Allensbach-Studie zufolge teilen 65 Prozent diese Einschätzung. Laut Umfrage werden selbst einstige Tabuwörter wie "Idiot" oder "Scheiße" salonfähig. Demnach benutzen 71 Prozent das Wort "Idiot" selbst, "Scheiße" 63 Prozent. Über das Wort "geil" regt sich nur noch jeder Fünfte auf.
Immer mehr Anglizismen
Wörter wie "Titten" oder "Ficken" stoßen allerdings viele ab, vor allem Frauen und Ältere. Mit dem Bildungsgrad hat die Verwendung der "Gossensprache" allerdings nicht viel zu tun, ganz im Gegenteil: Grundsätzlich verwenden Befragte mit Abitur und Studium die abgefragten "Tabuwörter" häufiger als diejenigen mit einfacher Schulbildung.
Auch an die zunehmende Verwendung von Anglizismen wie "Kids", "Event" oder "Meeting" haben viele Deutsche gewöhnt. Nur noch 39 Prozent - vor allem Ältere ohne Englischkenntnisse - stören sich daran. Die Jungen dagegen bedauern die Verdrängung der deutschen Sprache seltener und meinen sogar, dies mache die deutsche Sprache moderner und internationaler.
Die Rechtschreibreform ist weiter ungeliebt: Nur neun Prozent haben sich laut Umfrage mit ihr angefreundet. Die Mehrheit (55 Prozent) ist dagegen.
Die Rechtschreibkenntnisse der Bevölkerung haben sich in den letzten 20 Jahren trotz der Explosion höherer Bildungsabschlüsse in diesem Zeitraum weder verbessert noch verschlechtert. Ein Wort wie "Rhythmus" konnte damals wie heute nur knapp jeder Dritte korrekt schreiben.
Mundart wird noch von jedem Zweiten gesprochen, mit leicht abnehmender Tendenz. Am beliebtesten bleiben Bayerisch und norddeutsches Platt. Dagegen hat sich die Abneigung gegen Sächsisch noch verstärkt. 54 Prozent der Befragten mögen diesen Dialekt überhaupt nicht.
Für die im Auftrag der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) erstellte Studie wurden vom 4. bis 17. April 1820 repräsentativ ausgewählte Personen ab 16 Jahren befragt.