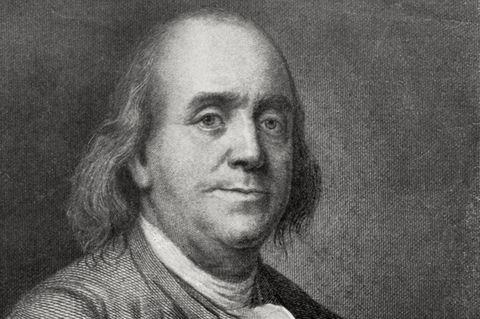Kaum lag Ödipus zum ersten Mal in den Armen der Amme, wurde er ihr entrissen und ausgesetzt. Mutter Iokaste und Vater Laios wollten mit ihrem Neugeborenen nichts zu tun haben. Der Grund: Das Orakel von Delphi hatte vorhergesagt, ihr Sohn werde großes Unheil über die Familie bringen. Ödipus' Schicksal war kein Einzelfall. In der griechischen Mythologie wimmelte es nur so vor Kindern, die sich selbst überlassen wurden. Die Sagenwelt aber war keine krude Fantasterei, sondern spiegelte die Realität im alten Griechenland wider. Und die war bei weitem grausamer als die der chaotischen Super-Nanny-Familien im TV.
Denn die griechischen Patriarchen entschieden über Tod oder Leben. Wurde ein Säugling als nicht lebenswert erachtet, brachte man ihn um. Meistens traf es die Mädchen. Kein Wunder also, dass Mütter sich keine Gefühle erlaubten. Weil sie befürchten, ihr Kind könnte am nächsten Tag schon tot sein, unterdrückten sie ihre Mutterliebe. Auch sonst blieb ihnen kein Raum, sich emotional auf ihr Kind einzulassen. Kaum hatten sie ihre Funktion als Gebärmaschine erfüllt - im Durchschnitt hatte jede Frau zehn Geburten - mussten sie die Kinder, beziehungsweise die Knaben, dem Vater überlassen. Die Erziehung blieb in seinen Händen, unterstützt wurde er dabei von männlichen Sklaven.
Eiskalte Gebärmaschinen: Mütter in der Antike
Am liebsten hätten die alten Griechen übrigens komplett auf Frauen verzichtet - Bierflaschen mussten noch nicht aus dem Kühlschrank geholt werden und Sex hatten sie ohnehin lieber mit Jünglingen. Auch das Kinderkriegen hätten sie gerne selbst erledig, so wie zum Beispiel Göttervater Zeus, der seine Tochter Athene angeblich aus seinem Scheitel gebar. Wenn wundert es da, dass viele Frauen der Antike mit der Mutterschaft nichts am Hut hatten. Oder mit Euripides' Medea gesprochen: "Lieber dreimal steh'n im Schildgedräng', als einmal niederkommen".
Mittelalter: Sehnsucht nach dem Mutterideal
Im Mittelalter war man regelrecht vernarrt in das Thema Mutter und Kind. 400 Jahre lang, beginnend im 13. Jahrhundert, folgten die Maler dem Geschmack der Massen und pinselten deren liebstes Motiv auf die Leinwand: Madonna mit Jesuskind. Maria prägte das Ideal der selbstlos liebenden, aufopferungsvollen Mutter. Ihrem Vorbild zu folgen war jedoch reines Wunschdenken. Telenovela-Ersatz sozusagen. Denn die Lebensbedingungen waren so hart, dass ein idyllisches Mutterdasein ausgeschlossen war. Wegen der hohen Kindersterblichkeit - fast jedes zweite Kind starb - verkümmerte die Mutterliebe.
Noch im 18. Jahrhundert war man meilenweit entfernt von dem Typus Mama, der duftigen Weichspüler verwendet und Pausenbrote schmiert. Frauen kümmerten sich kaum um ihre Nachkommen. Sie sicherten ihre Existenz durch harte Arbeit oder gingen ihrem Vergnügen nach. Etwa 95 Prozent aller Mütter weigerten sich, ihre Säuglinge selbst zu stillen, und gaben sie an Ammen ab. In Paris häuften sich die Berichte über verwahrloste Kinder, viele Neugeborene starben an Vernachlässigung. 1762 erschien der Roman "Emile oder über die Erziehung" von Jean-Jacques Rousseau. Darin postulierte der Philosoph die Grundlagen einer neuen Weltanschauung, die der Aufklärung, und sprach der Mutter eine große Bedeutung zu. Die enge Mutter-Kind-Bindung wurde von nun an zu einem Muss. Kritikerinnen wie die französische Philosophin Élisabeth Badinter sehen die von Rousseau propagierte Bindung heute allerdings als Mittel zur Unterdrückung emanzipatorischer Impulse.
Hängt immer alles an der Mutter?
Rousseau hatte Müttern mit der Forderung, Erziehung zu ihrer Lebensaufgabe zu machen, auch eine immense Last aufgebürdet. Aber: hängt wirklich alles an der Mutter? Ja, glaubt man beispielsweise der Psychoanalytikerin Anna Freud. Das Verhalten der Mutter beeinflusse laut Freud die lebenslange Entwicklung des Kindes. Darin liegt die unausgesprochene Forderung: "Mütter, macht bloß alles richtig, sonst kriegt euer Kind einen Schaden für's Leben."
Die Pille veränderte in den 60er-Jahren die Einstellung zur Mutterschaft. Frauen entschieden sich reihenweise gegen Nachwuchs und für einen Beruf. Feministinnen lehnten sich gegen die Mutterschaft auf. Sie sei Ursache für Ungerechtigkeit und Unterdrückung. In den 70er- und 80er-Jahren kamen wieder mehr Kinder zur Welt. Die Mütter steckten in einem Dilemma, das sich bis heute nicht relativiert hat: sie wollen dem Ideal der liebenden Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, entsprechen und außerdem berufstätig sein. Kind plus Karriere - das muss laufen. Inzwischen bekommt Mutterschaft sogar ein bisschen Glamour ab: prominente Damen präsentieren ihren Babybauch genauso gerne wie ihre Manolo Blahniks.