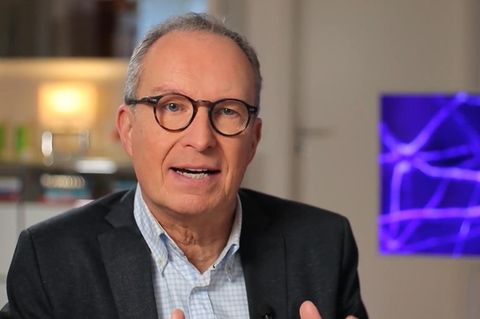Sehen ist ein Kinderspiel. Wir öffnen die Augen, und die Welt knallt uns ins Bewusstsein. Das Abbild unserer Umgebung ist farbig, detailgetreu, perspektivisch vertraut und randvoll mit Informationen über Entfernungen, Dimensionen und räumliche Tiefe. Haben wir genug geschaut, klappen wir die Augenlider zu, und einschläferndes Dunkel füllt den Schädel. Gibt es etwas Einfacheres, Praktischeres und Bequemeres als Sehen? Mit Abstand ist das Sehen unser erster und wichtigster Sinn. Der Mensch ist ein Augentier, sein Verhalten wird vor allem von optischen Wahrnehmungen bestimmt. Augen sind unser „Tor zur Welt“, liefern sie uns doch rund 80 Prozent aller Eindrücke von ihr – so lange sie einwandfrei funktionieren. Das allerdings scheinen sie nur noch bei einer Minderheit zu tun. Laut der aktuellen Brillenstudie 2005 des Allensbacher Instituts für Demoskopie im Auftrag des Kuratoriums Gutes Sehen gibt es in Deutschland knapp 42 Millionen Brillenträger. Davon sind 40,4 Millionen Erwachsene ab 16 Jahren, 1,5 Millionen sind Kinder zwischen zwei und 15 Jahren. Hinzu kommen Verfallserscheinungen wie der graue Star und gefährliche Augenerkrankungen wie der grüne Star oder die Makula-Degeneration. Bemerkt der von ihnen Heimgesuchte die Warnzeichen nicht, können irreparable Schäden bis hin zur Erblindung die Folge sein. Ein Grundwissen über das Auge und seine Schwachstellen zu besitzen lohnt sich deshalb für jedermann. Das Innenleben der beiden murmelförmigen Organe von je 24 Millimeter Durchmesser ist der großen Masse der Sehenden dennoch beinahe vollständig unbekannt. Zwar kann selbst die Medizin nicht mit der Präzision erklären, die ihr lieb wäre, wie es die beiden Hohlkugeln aus je sechs Gramm Wasser und anderthalb Gramm Zellgewebe schaffen, ein derart perfektes Abbild der Umgebung in unser Bewusstsein zu projizieren. Und wie es ihnen möglich ist, in puncto optische Leistung, Zuverlässigkeit, Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse, Miniaturisierung, Energieverbrauch und Lebensdauer alle modernen Kameras in den Schatten zu stellen. Die Grundfunktionen des Auges sind jedoch hinreichend geklärt.
Wenn wir einen Gegenstand anschauen, etwa einen röhrenden Achtzehnender auf einer blumenübersäten Alpenwiese, dringen die von Grünfläche und Hirsch reflektierten Lichtstrahlen in unsere Augen, werden dort gebündelt und auf die Netzhäute geleitet, die sie in elektrische Impulse umwandeln und an das Sehzentrum in der Großhirnrinde senden. Dort wird das Bild errechnet, das wir sehen. Die auf das Alpenidyll gerichteten Augen besitzen ein optisches System, das aus Hornhaut, Regenbogenhaut, Linse und Glaskörper besteht (siehe Zeichnung Seite 42). Die Hornhaut ist nicht nur die äußere Hülle des sichtbaren Auges, auf die man Kontaktlinsen klatscht und die mit Straßenstaub und giftigen Abgasen fertig werden muss. Sie ist auch ein wichtiges optisches Element. Ihre Brechkraft beträgt erstaunliche 45 Dioptrien*. Das entspricht einem Brillenglas von der Dicke eines hinterbayerischen Wirtshausaschenbechers. Da von außen gut zugänglich, lässt sich dieses erste optische Element im Sehapparat des Auges leicht operieren: Verändert der Arzt durch künstliche Verformung die Brechkraft der Hornhaut, was heute meist mit Hilfe von Laserstrahlen gemacht wird (siehe Interview Seite 48), lässt sich dadurch selbst starke Kurzsichtigkeit dauerhaft beseitigen.
Das etwa 1,3 Quadratzentimeter große Fenster zur Außenwelt wird von Tränenflüssigkeit benetzt und geschmiert, entspiegelt, gesäubert und desinfiziert. Zehn bis 15 Lidschläge pro Minute verteilen das Vielzwecknass. Solange nicht allergische Reizung oder Entzündung die Schleimhäute rund ums Auge plagen, funktioniert das reibungslos und unbemerkt. Brennt und juckt das Auge aber über längere Zeit, ist eine ärztliche Untersuchung angesagt. Womöglich mangelt es an Tränenflüssigkeit, und das Auge wird zu trocken. Künstliche Tränen schaffen Abhilfe. Und Vorsicht! „Im Auge ist im Körper“, heißt eine alte Medizinerweisheit. Das bedeutet: Nie darf Schmutz ins Auge eingerieben werden, bunte Zierkontaktlinsen dürfen keinesfalls mit Freunden getauscht werden, und Augentropfen, die kurzfristig gegen Juckreiz oder während der Heuschnupfensaison auch für längere Zeit benutzt werden, müssen steril verpackt geliefert und schnell verbraucht werden.
Nach Bündelung in der Hornhaut durchqueren die Lichtstrahlen die vordere Augenkammer, die Pupille in der Regenbogenhaut und die Augenlinse, wo sie weiter konzentriert werden. Die vordere Augenkammer ist ein mit „Kammerwasser“ gefüllter Hohlraum zwischen Hornhautrückseite und Regenbogenhaut. Letztere Membran, auch Iris genannt, prägt die Augenfarbe. Enthält sie – das ist genetisch festgelegt – wenig Pigmente, erscheinen die Augen blau, steckt sie voller Farbstoffe, sind sie dunkelbraun.
Das Kammerwasser wird in der hinteren Augenkammer – dem Abschnitt zwischen Regenbogenhaut und Linse – gebildet und dient unter anderem der Ernährung von Hornhaut und Augenlinse. Täglich werden zwei bis drei Kubikzentimeter Flüssigkeit produziert. Der Überschuss fließt über ein Ventilsystem durch den „Schlemmschen Kanal“ aus der vorderen Augenkammer ab. Ist das feine Drainagesystem verstopft, steigt der Druck im Augeninnern.
Hoher Augendruck kann den grünen Star bewirken, eine Unterversorgung von Sehnerv und Teilen der Netzhaut mit Blut und Sauerstoff (der Begriff „Star“ hat nichts mit Singvögeln zu tun, er kommt von „starren“). Die Krankheit ist tückisch: Jahrelang lebt der Befallene mit ihr, ohne Symptome zu verspüren. Doch währenddessen schreitet bereits die Zerstörung des Sehnervs voran. Erst in einem späten Stadium des grünen Stars schwinden Teile des Gesichtsfelds, das Bild der Welt bekommt dunkle Felder. Rechtzeitig erkannt, kann der grüne Star jedoch gut behandelt werden. Spezielle Augentropfen senken den Augeninnendruck, und gegebenenfalls lässt sich der verstopfte Abfluss auch mittels Operation oder Laserbehandlung wieder frei machen. Experten schätzen, dass zwei Millionen Deutsche am grünen Star leiden, aber nur jeder zweite behandelt wird. Weil zehn Prozent der über 40-Jährigen als gefährdet gelten, empfehlen Experten dieser Altersgruppe, mindestens einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Zuckerkranke, Kurzsichtige mit mehr als fünf Dioptrien und familiär Vorbelastete sollten ihren Augendruck sogar viermal im Jahr messen lassen. Unbedingt rasch zum Arzt muss gehen, wer beim „Amsler-Test“ auf der Rückseite des -Sehtest-Posters Auffälligkeiten entdeckt, etwa Lücken im Gitter oder „verbogene“ Stäbe.
Die Pupille ist das transparente Zentrum der Iris, der Grenze zur hinteren Augenkammer. Die Pupille funktioniert wie eine fotografische Blende und kann sich mit Hilfe zweier Muskeln blitzschnell auf zwei Millimeter verengen, etwa bei gleißender Helligkeit, und sich in finsterer Nacht bis auf etwa acht Millimeter öffnen.
Die hinter ihr liegende Linse ist winzig. Sie hat neun Millimeter Durchmesser und ist vier Millimeter dick. So genannte Zonulafasern verbinden ihre Peripherie mit einem Muskel, der sie ringförmig umschließt – ihrem Zoom-Motor. Die Wirkungsweise dieses „Ziliarmuskels“ ist relativ kompliziert: In Ruhestellung des menschlichen Auges – etwa, wenn man in die Ferne blickt – ist er entspannt. Er ist dann so weit vom Rand der Linse entfernt, dass die Fasern, die ihn mit dieser verbinden, gestrafft sind. So üben sie von allen Seiten einen gleichmäßigen Zug aus und halten die Linse flach. Ihre Brechkraft beträgt in dieser Stellung etwa 19 Dioptrien.
Visiert man einen nahen Gegenstand an – beispielsweise die Armbanduhr –, zieht sich der Ziliarmuskel zusammen. Dadurch nähert er sich der Linsenperipherie, die Spannung der Zonulafasern nimmt ab, und die Linse wölbt sich aufgrund ihrer Eigenelastizität auf. Als Konsequenz steigt ihre Brechkraft auf maximal 33 Dioptrien, und nahe Gegenstände werden scharf abgebildet. Das Ganze nennt man Akkommodation. Je jünger der Mensch, desto besser kann er akkommodieren, je älter, desto schlechter. Zehnjährige vermögen auf nur acht Zentimeter Entfernung knallscharf zu sehen, 40-Jährige noch auf 17 Zentimeter. Bei 70-Jährigen liegt der Punkt des nächs-ten Sehens bei etwa einem Meter. Kein Wunder, dass dann die Arme oft zu kurz zum Zeitunglesen sind. Und so kommt es, dass den meisten Zeitgenossen ab etwa 45 Jahren der Griff zur Lesebrille nicht erspart bleibt. Die Ursachen der Alterssichtigkeit sind umstritten. Früher glaubte man, dass die Linse allein an den Problemen schuld sei, weil sie im Laufe der Jahre ihre Elastizität verliere und nicht mehr in der Lage sei, sich ausreichend zu krümmen, wenn der Zug der Zonulafasern nachlasse. Neuere Forschung deutet aber darauf hin, dass auch Verschleiß im Zugapparat der Fasern am Verlust des Nahsehens beteiligt ist.
Die Sammellinsen der Lesebrille fügen verlorene Brechkraft wieder hinzu, die Zeitungsbuchstaben sind wieder scharf. Bis etwa zum 60. Lebensjahr nimmt die Stärke der benötigten Lesebrille zu, dann ist ein bleibender Maximalwert erreicht. Wie gut das Nahsehen funktioniert, lässt sich mit dem Lesetest auf der Rückseite des -Sehtest-Posters überprüfen.
Unschärfe und Nebelschleier dagegen können auf einen Katarakt hinweisen, einen grauen Star. Das ist eine Trübung der Augenlinse, die vermutlich durch entartete Proteine verursacht wird. Auf jeden Fall enthält die Augenlinse eines Zehnjährigen nur etwa drei Prozent unlöslicher Eiweißstoffe. Bei einem 80-Jährigen sind es dagegen rund 40 Prozent.
Jedes Jahr werden in Deutschland rund 500 000 getrübte Linsen entfernt und durch Kunststoffimplantate ersetzt. Der Eingriff erfolgt meist bei örtlicher Betäubung und dauert nur zehn Minuten.
Wenn die Lichtstrahlen die Linse und den Glaskörper, die klare, gallertartige Füllung des Augapfels, passiert haben, treffen sie gebündelt auf die Netzhaut. Diese nur Bruchteile eines Millimeters dünne Gewebeschicht enthält die Sehzellen – rund 120 Millionen „Stäbchen“, die das Hell und Dunkelsehen ermöglichen, und zirka sieben Millionen „Zapfen“, die für das Tag-Sehen und die Farberkennung zuständig sind. Sämtliche Rezeptoren sind über ein komplexes Geflecht von Nervenfasern mit dem Sehnerv verkabelt.
Auf der Netzhaut entsteht das Abbild des Hirsches auf der Wiese stark verkleinert, auf dem Kopf stehend und obendrein seitenverkehrt. Aber das Sehzentrum in der Großhirnrinde lässt sich weder dadurch irritieren noch durch die Tatsache, dass beide Augen unterschiedliche, einander überschneidende Bilder anliefern. Aus den Daten errechnet es das dreidimensionale Bild eines virtuellen Ein-Auges, das, würde es tatsächlich existieren, genau in der Mitte zwischen unseren realen Augen säße.
Der Nah-Lese-Test des -Posters entlarvt ebenfalls, bereits in jüngeren Jahren, eine Weitsichtigkeit. Dieser optische Fehler kommt zustande, wenn der Augapfel zu kurz gewachsen ist. Die Linse kann dann bei der Akkommodation kein scharfes Bild auf die Netzhaut zeichnen, denn die ist dazu zu nah: Eine optimale Abbildung würde erst jenseits ihrer lichtempfindlichen Zellen entstehen. Ebenso wie die Alterssichtigkeit lässt sich die Weitsichtigkeit mit Sammellinsen („Plusgläsern“) ausgleichen.
Dauernder Nahblick ist eine moderne Gewohnheit: Während die Urmenschen wohl nur selten, etwa beim Lausen und der Steinbeilproduktion, akkommodieren mussten, zwingt der moderne Mensch seine Augen beim Lesen und Internetsurfen oft zwölf und mehr Stunden am Tag zum Nahsehen fast ohne Pause. Für diese Art einseitiger Dauerbeanspruchung scheinen unsere Sehwerkzeuge aber nicht ausgelegt zu sein. Vor allem in der Jugend, wenn der Augapfel noch wächst, können Surf- und Leseorgien womöglich zu Kurzsichtigkeit (Myopie) führen: Der Augapfel wächst übermäßig in die Länge, das scharfe Bild eines fernen Gegenstandes hängt vor der Netzhaut „in der Luft“, oder besser: im Glaskörper. Schon längst ist die Myopie zu einer modernen Massenepidemie geworden. In den europäischen Industrieländern kommen je nach Berufsgruppe bis zu 60 Prozent nicht mehr ohne Brille aus. In manchen Ländern Asiens sind sogar über 90 Prozent der Studenten kurzsichtig. Konsequenz: Ihr „Fernvisus“, die Sehschärfe ab einigen Metern Entfernung, ist gefährlich niedrig. Oft reicht er nicht aus, um sich beispielsweise sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Leicht bestimmen lässt sich der Fernvisus mit den „Landolt-Ringen“ auf der Vorderseite des Sehtest-Posters. Liegt er deutlich unter 1,0, ist es Zeit für den Besuch bei Augenarzt oder -optiker. Mit Streulinsen („Minusgläser“) verändert der die Brechkraft der Augenoptik so, dass das scharfe Bild nach hinten auf die allzu ferne Netzhaut verschoben wird.
Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass nur ein klitzekleiner Ausschnitt von dem, was sie sehen, wirklich scharf ist. 95 Prozent der Sehschärfe sind nämlich in dem winzigen Netzhautpunkt geballt, den die gebündelten Lichtstrahlen treffen. Der „gelbe Fleck“, auch „Makula“ genannt, hat einen Durchmesser von nur etwa eineinhalb Millimetern. Hier ist die Dichte der Rezeptorzellen am höchsten. Die anderen Netzhaut-Areale sind im Vergleich zur adleräugigen Makula blind wie ein Maulwurf.
Wer nicht glauben will, dass er einer Illusion erliegt, wenn er meint, alle Dinge in seinem Gesichtsfeld seien scharf, dem verhilft ein simpler Test zu der Erkenntnis: Man visiert konzentriert die Spitze eines Zeigefingers an, den man sich etwa einen halben Meter vor die Nase hält. Am besten wählt man als Hintergrund keine konturlose Tapete, sondern eine detailreiche Bilderwand oder ein Bücherregal. Bleibt man diszipliniert und lässt den Blick unverwandt an der Fingerkuppe kleben, während man die Abbildungsqualität ihrer Umgebung abzuschätzen sucht, ohne aktiv dorthin zu sehen, erkennt man, dass alles Übrige nur verwaschen zu sehen ist.
Weil die Makula so entscheidend für unser Sehen ist, sind Erkrankungen des winzigen Netzhautareals meist eine Katastrophe für den Visus der Betroffenen. So kommt es, dass die „altersbedingte Makuladegeneration“ (AMD) die häufigste Erblindungsursache bei älteren Menschen ist. Mehr als ein Drittel der schätzungsweise 155 000 blinden Deutschen haben ihr Augenlicht durch AMD verloren. Jedes Jahr gibt es etwa 60 000 Neuerkrankungen.
AMD und die anderen Spielarten der Makula-Degeneration sind in der Regel schmerzfrei und verlaufen schleichend. Man wird sich ihrer meist erst dann bewusst, wenn Lesen immer schwerer fällt, die Umwelt unscharf wird und sich ein störender Grauschleier über alles legt. Bei einigen Arten der Makula-Degeneration können neue Medikamente und Operationsverfahren helfen. Zur Früherkennung eignet sich das Amsler-Gitter auf der Rückseite des Sehtest-Posters. Dessen regelmäßige Nutzung, etwa im Abstand von einem Jahr, lohnt sich.
Nicht nur, weil der Alltag bei schlechter werdender Sicht zunehmend riskanter und unbequemer wird; für viele Augenprobleme gilt auch: Je früher der Arzt sie behandelt, desto besser sind die Chancen, die Sehkraft zu erhalten. Dann bleibt Sehen ein Kinderspiel, viele Jahrzehnte lang.