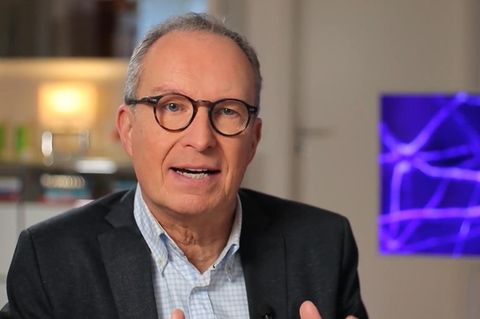Herr Schweitzer, wenn ein Mensch dauerhaft erkrankt, übernehmen oft - die Angehörigen die Pflege. Wo liegen die Hauptgefahren für diese Familien?
Wenn Pflegende ihren Einsatz langfristig als wichtigste Lebensaufgabe ansehen, kann dies auf beiden Seiten zu Autonomieverlust führen. Die Gratwanderung zwischen notwendiger Unterstützung, behindernder Fürsorge und gegenseitiger Abgrenzung fällt vor allem Anverwandten häufig schwer. Dann lohnt es sich zu fragen: Wie viel Verantwortung kann ich für den Kranken übernehmen, ohne ihn zu bevormunden? Wie viel Freiraum kann ich ihm, aber auch mir selbst, zugestehen, um zu helfen und gesund zu bleiben?
Wie finden Familien den Mittelweg zwischen Pflege und Abgrenzung?
Angehörige müssen sich heute seltener entscheiden, ob sie einen Kranken rund um die Uhr pflegen oder ihn in ein Heim geben wollen. Mittlerweile gibt es viele Zwischenlösungen. Für Menschen, die an einer Psychose leiden, bieten zum Beispiel in vielen Städten sozialpsychiatrische Einrichtungen Aufenthalte über den Tag an, sodass die Abende in der Familie verbracht werden können. Ebenso gibt es betreutes Gruppen- oder Einzelwohnen. Im akuten Fall sollte der Betroffene den Klinikaufenthalt erwägen, allerdings rechtzeitig bei ersten psychischen Anzeichen.
Und was können Angehörige tun, um ihre Situation besser zu ertragen?
Sie können sich zum Beispiel Menschen suchen, die sich in ähnlicher Lage befinden. Das kann in Selbsthilfegruppen oder Angehörigenverbänden geschehen. Sehr wirkungsvoll sind die sogenannten Psychoseseminare von Dorothea Buck und Thomas Bock. In Gesprächsrunden tauschen sich dort Patienten, Angehörige und oft auch Fachleute gleichberechtigt über ihre Erfahrungen mit der Psychose aus. Das gemeinsame Ziel lautet: Psychotisches Erleben ist verstehbar, alle Parteien können etwas voneinander lernen.
Eltern von psychisch kranken Kindern plagen häufig Schuldgefühle. Wie reagieren Sie darauf?
Vielfach schämen sich Eltern, weil sie meinen, sie hätten in der Erziehung ihres kranken Kindes etwas falsch gemacht. Sie denken: "Unsere Fehler sind nun für jedermann sichtbar." Oder sie sagen sich: "Wir kommen aus einer genetisch labilen Familie" und ziehen sich zurück. Doch die Frage nach der Schuld bringt im Nachhinein nichts. Wir Therapeuten verzichten heute bewusst auf eine intensive Ursachenerforschung. Dies würde die Familienmitglieder, vor allem die Eltern, unnötig pathologisieren. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Suche nach Auswegen und Lösungen für die daraus entstandenen Probleme.
Auch gesunde Geschwister tragen die Last des Leidens und geraten in der Familie ins Abseits.
Das stimmt. Angehörige Geschwister beschreiben dies häufig, nicht nur bei Fällen von psychischen, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen in der Familie. So berichten beispielsweise Geschwister leukämiekranker Kinder im Rückblick oft, durch die Familiensituation seien sie einerseits im Leben unabhängiger geworden. Andererseits hätten sie ständig das Gefühl gehabt, dass sie nichts zu laut hätten einfordern dürfen, weil das gegenüber dem kranken Kind unmoralisch gewesen wäre. Auf Dauer reagieren diese Geschwister frustriert, wenn sie den Eltern nicht sagen können, was ihnen fehlt, wie sie sich fühlen, und ihre Bedürfnisse in den Hintergrund rücken sehen.
Was tut diesen Geschwistern in einer solchen Situation gut?
Zum Beispiel mehr mit ihren gesunden Geschwistern zu unternehmen oder mit den Eltern gezielt über ihr eigenes Leben zu sprechen. Vielleicht finden sich auch gemeinsame Interessen mit dem kranken Geschwister. Das sollte jedoch unter der Voraussetzung geschehen: Ich kann das tun, muss aber nicht. Die Deutsche Krebshilfe hat das Problem erkannt und bietet Betreuung für Geschwisterkinder an. Betroffene Familien können sich zum Beispiel an den Wochenenden im Waldpiraten-Camp der Kinderkrebsstiftung in Heidelberg erholen. In Seminaren oder Spielstunden erfahren angehörige Geschwister dort besondere Aufmerksamkeit und lernen, mit der Krankheit in der Familie umzugehen.
Was raten Sie betroffenen Familien, wie sie Konflikten oder Entfremdungen begegnen können?
Ich bin kein Freund von Pauschallösungen. In einer Therapie, würde ich jedes Familienmitglied fragen: Was schlagen Sie vor? Ich lenke die Teilnehmer im -Gespräch, damit sie selbst Lösungen für bestehende Probleme im Familienkreis finden. Gemeinsam überlegen wir, welche Schritte zu einer glücklicheren Entwicklung führen könnten und was jeder der Beteiligten zu dieser beitragen kann. Beispielsweise frage ich, in welchen Situationen es einer Familie schlecht miteinander ergangen ist und wann gut. Was waren die Umstände oder Auslöser dafür, und was hat Besserung gebracht? Ich fokussiere dabei auf die guten Momente und frage etwa die Eltern, wann sie mit den gesunden Kindern zuletzt angenehmen Kontakt hatten. Ebenso motiviere ich die Angehörigen, in ungewohnt gewordenen Konstellationen etwas miteinander zu unternehmen. Zum Beispiel könnten Eltern und gesunde Kinder einen gemeinsamen Wochenendausflug auch ohne das erkrankte Mitglied unternehmen.
Interview gefunden in Gesund Leben, 04/2010
Zur Person
Privat Jochen Schweitzer ist Professor für Psychologie und Familientherapeut an der Universität Heidelberg.