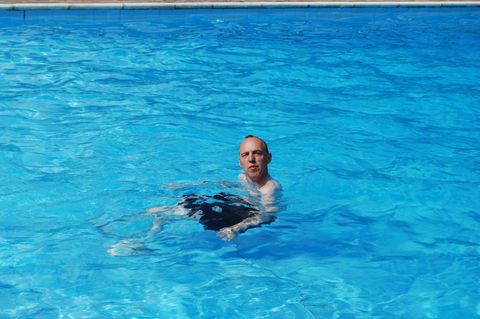Die schlechte Nachricht zuerst: Conni wird ewig leben. Ja, die Conni. Die das Seepferdchen macht. Die ein neues Fahrrad bekommt. Oder ein neues Geschwisterchen. Die Conni, die immer auf zehn mal zehn Zentimetern oder auch auf 24 Seiten daherkommt. Die ständig lacht, auch wenn sie mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt. Die Conni, die irgendwie nervt.
Aber unsere Kinder werden Conni weiterhin lieben, der Himmel weiß, warum - ihre Geschichten sind etwa so spannend wie Bahnsteigansagen. Und wenn wir am nächsten Buchladen vorbeigehen oder an der Kasse im Drogeriemarkt stehen, werden die Kinder Conni sehen und schreien: "Kann ich noch ein Pixi-Buch?!"
Das hören Eltern nun seit einem halben Jahrhundert. Also: Glückwunsch, lieber Carlsen-Verlag, zu 50 Jahren Pixi-Büchern. Glückwunsch zu 250 Millionen verkauften Exemplaren, zu durchschnittlich vier Millionen Euro Umsatz pro Jahr mit Figuren wie Petzi, Kapitän Sternhagel, dem kleinen Knäckebrotmonster und vor allem, na gut, mit Conni. 16.000 verkaufte "Pixis" täglich - das ist sehr sehr viel im deutschen Buchhandel.
Da hatte also der dänische Verleger Per Hjald Carlsen ein sicheres Gespür bewiesen, als er 1948 in Amerika die "Pixie Books" entdeckte (benannt nach "pixy", englisch für "Kobold") und sich sofort die Rechte sicherte. 1954 erschien der Band "Miezekatzen", die erste deutsche Lizenzausgabe - und von heute aus betrachtet das perfekte Abbild einer verspießten, restaurativen Nachkriegsgesellschaft: Gräulich verschmuste Kindchenschema-Kittys tummeln sich da, der Text gemahnt an Zeiten, in denen Pädagogik aufs Einpassen und nicht aufs Entwickeln zielte. Das Katzenkind lutscht am Daumen, und um unseren Kleinsten klar zu machen, auf welchem Höllentrip es ist, wird gespottet: "Mit frischen Jungen spielt ein jeder/doch nicht mit solchem Lutsche-Peter."
"Pixis waren nie fortschrittlich", sagt Maria Linsmann, Direktorin des Bilderbuchmuseums Troisdorf, in dem derzeit alle 1300 erschienenen Minibücher zu sehen sind. "Pixis sind eher dafür bekannt, Trends zu ignorieren. Es hat lange gedauert, bis auch mal modernere Illustratoren ein Buch zeichnen durften." Michael Kuznik, 37-jähriger Besitzer aller Pixi-Bücher, hat schnell ein Exemplar von 1962 zur Hand, das heute zu einer ausgewachsenen politisch korrekten Debatte führen würde. Es heißt "Wir reisen um die Welt", und was "Kosmopolit" in den frühen 60ern hieß, kann man hier sehr schön nachlesen: "Fröhlich laufen die Negerkinder an den Strand. Sie bringen Bananen und Kokosnüsse mit".
Ein paar Seiten später lassen sich die weißen Kinder von vier schwarzen Jungen tragen - in einer Sänfte. Auch die Geschlechterrollen sind in den "Pixis" bis in die 80er klar verteilt: Mutti im Heim am Herd, Papa auf Maloche, noch im Jahr 1973 erscheint Büchlein 190 mit dem erfrischenden Titel "Hilda Putzteufel". Aufklärung erfolgt im Pixi-Buch "Totte und Monika" (1985) ein wenig unterkühlt: "Totte hat einen Penis, Monika eine Scheide. Wenn Totte groß ist, wird er ein Vater. Wenn Monika groß ist, wird sie eine Mutter." Erst 1995, in Pixi Nummer 764, darf der Junge Max in einer Werkstatt die Mechanikerin Rea treffen.
Aber wir wollen nicht ungerecht sein: Wer den Massengeschmack treffen will, kann nicht gleichzeitig Trendsetter sein. Außerdem gibt es natürlich auch witzige Pixis (Nummer 998: "Liebespaa... küsst euch maa!", herrlich absurd) und sogar besondere: "Die erste Schokolade", eines der wenigen Bilderbücher über Trümmerfrauen. Und eins haben Pixis immer geschafft: Kinder zum Lesen gebracht, zuverlässig, jahrzehntelang. Auch wenn es weiterhin Geschichten mit der blöden Conni sind.
Stephan Draf